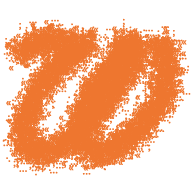Jens Kastner
The Words of the Arty Class.
Zur Sprachlosigkeit der working class
in den Künsten
The Words of the Arty Class.
Zur Sprachlosigkeit der working class
in den Künsten
Bildende Kunst als Klassenkunst
Der Klassencharakter gehört zur bildenden Kunst wie Öl auf Leinwand. Gemeinhin wird er unsichtbar gemacht, dagegen aber gibt es Widerstan.
In einem Vortrag fragte sich der marxistische Kunsttheoretiker Max Raphael einst titelgebend: „Wie soll sich der Arbeiter mit Kunst beschäftigen?“ Sich diese Frage zu stellen, geht von der offenkundigen Annahme aus, dass die Antwort sich nicht von selbst versteht. Für den Bürger und die Bürgerin vielleicht, für die Arbeiter*innen anscheinend nicht. Es gibt da also etwas zu differenzieren, nämlich das Kunstpublikum. Diese Annahme ist begründet: Der Bürger habe die Vorstellung durchgesetzt, schreibt Raphael, „es gebe nur eine, seine Kunstbetrachtung und diese sei klassenlos, bedingungslos, ewig immer dieselbe“1. Raphael fordert damit eine soziologische und eine ideologiekritische Perspektive zugleich: Von kunstsoziologischer Warte aus wird die allzumenschliche Einheit der Kunstbetrachter*innen infrage gestellt. Die ideologiekritische Herangehensweise fragt danach, wie die Durchsetzung von Vorstellungen hergestellt wird, um sie schließlich zu kritisieren.
Vielleicht ist es in Zeiten von Van Gogh-Socken und virtueller Museumsrundgänge, von Warenästhetik und Kreativitätsimperativ kaum mehr nachvollziehbar, dass die bildende Kunst eine Klassenkunst ist, in ihrer Genese verknüpft mit gesellschaftlichen Spaltungen und den mit ihnen verbundenen Kämpfen um die Denk- und Wahrnehmungsweisen. Auch wenn wir es mehr und mehr mit einer „zentrifugale[n] Kunst“² zu tun haben, wie der Soziologe Andreas Reckwitz meint, in der sich Praktiken künstlerischer Produktions- und Rezeptionsweisen – von Formfragen bis zu lebensweltlichen Verhaltensweisen – auf andere, fast alle gesellschaftlichen Bereiche ausdehnen, sind nach wie vor nicht alle Rezeptions- und Umgangsweisen gleich legitim. Der „ästhetische Blick“, von Pierre Bourdieu als eine von allen Nützlichkeitskriterien gereinigte Art des Sehens beschrieben, ist doch nach wie vor ein wesentlicher Bestandteil, wenn nicht die dominant erforderte Disposition für die Kunstpraxis – Produktion wie Rezeption.³ Gereinigt von allen nicht-künstlerischen, also religiösen, moralischen, politischen u.a. Kriterien wurde die bildende Kunst erst mit der Etablierung der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaftsformen. Die Aneignung von Kunst verlief fortan anders als diejenige anderer kultureller Güter. Wie Raphael stellt auch Bourdieu heraus, dass dabei eine „partikulare Erfahrung in den Rang einer transhistorischen Norm jeder künstlerischen Wahrnehmung“⁴ erhoben wurde. Umgesetzt in Praxis wird diese Norm in jenem gesellschaftlichen Bereich, den Bourdieu dann als ein sich konsolidierendes Feld der Kunst beschreibt, in dem andere Bewertungskriterien herrschen als in der Landwirtschaft oder vor Gericht. Hier tobt sich sozusagen die „partikulare Erfahrung“ des Bürgertums aus, die nicht unbedingt jene von Arbeitern oder indigenen Frauen* ist. Das Feld der Kunst erscheint bis heute, wie der Kunsthistoriker Wolfgang Ullrich meint, häufig als noch „exklusiver als Segelklubs“.⁵ Rezipiert wird die bildende Kunst nicht von einer breiten Öffentlichkeit, sondern von relativ kleinen Zirkeln ausgewählter Kunstfeldangestellter, Sammler*innen und Galerist*innen. Trifft die zeitgenössische Kunst doch mal auf eine größere Menge an Leuten, dann handelt es sich dabei meist um relativ gebildete und auch finanziell nicht eben arme Menschen. Selbst bei Blockbuster-Ausstellungen mit Werken von Picasso oder Warhol handelt es sich, wie auch bei Kunstmessen, so Franz Schultheis u.a. in ihrer Studie zur Art Basel, um „praktisch rein ‚akademische’ Veranstaltungen“.⁶ Angehörige sogenannter unterer sozialer Milieus finden sich dort überhaupt nicht.
Norbert Elias konstatierte 1935 die Entwicklung einer Sphäre der Kunstproduktion und -rezeption, die mit den allgemeinen Geschmacksvorlieben kaum mehr zu vermitteln ist. Die moderne Kunst ist ein Teilbereich der Kultur und nicht der verständlichste. „Das Unverständnis der berufstätigen Gesellschaft für ihre Kunst ist symptomatisch nicht für die soziale Spannung zwischen verschiedenen berufstätigen Schichten, sondern für den Riß und die Spannung zwischen dem Geschmack der großen Spezialisten, der großen Kunst aller Art auf der einen Seite und dem Geschmack der Massengesellschaft, der Nichtspezialisten auf der anderen Seite“.⁷ Durchgesetzt hat sich diese „Spezialistenkunst“⁸ laut Elias, da ist Bourdieu mit ihm einig, mit Manet und den Impressionist*innen im Frankreich der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Schon Marx hatte schließlich den aus der Teilung der Arbeit „hervorgegangenen Bildungsverhältnissen“⁹ nachgesagt, entscheidend dafür zu sein, ob etwas als Kunst wahrgenommen wird bzw. werden kann oder nicht.
Wie schon angedeutet, gehen zumindest die hier zitierten Kunsttheoretiker davon aus, dass zur Durchsetzung der „Spezialistenkunst“ auch gehört, die Spezialisierung zu leugnen, die besonderen Voraussetzungen von Zeit, Muße und Interesse für Kunst in den Hintergrund zu rücken, also ihren Klassencharakter unsichtbar zu machen. Dagegen trat unter anderem die Kultursoziologie Bourdieus an, in der der darauf hingewiesen wurde, dass künstlerische Arbeiten „die am stärksten klassifizierenden und Klasse verleihenden“¹⁰ aller Konsumgüter sind. Sich mit Kunst zu beschäftigen, ist demnach nicht nur Ausdruck einer Klassenposition, sondern bestätigt und festigt diese auch. Aber nicht nur die Soziologie, auch Künstler*innen selbst ließen die Klassenfrage keineswegs undiskutiert und richteten ihr Tun nicht selten gegen die bürgerlichen Grundlagen ihres Schaffens. Die Geschichte der Avantgarden ließe sich ohne diesen anti-bürgerlichen Impetus gar nicht schreiben, der die Verbindungen zum Gros der Bevölkerung aber eher erschwert statt hergestellt hat. Daneben existierten immer auch Ansätze in der Tradition der Realismen, von Gustave Courbet über Bertolt Brecht bis zu dokumentarischen Arbeiten konzeptueller Künstler*innen der Gegenwart, die auf Repräsentation von Arbeit und Klasse abzielten und die verschiedenen Formen von Arbeits- und Klassenverhältnissen ins Werk zu setzen versuchten. So tritt die Arbeiterklasse als kollektives Subjekt ins Bild von Guiseppe da Volpedo („Der vierte Stand“, 1901), im sozialistischen Realismus der 1920er und 1930er Jahre, etwa bei Diego Rivera, gestaltet die Klasse die Zukunft, bevor sie dann um 1968 als Massenbasis fraglich wird – im Film „Farbtest. Die Rote Fahne“ (1968) von Gerd Conradt rennen nur noch einzelne durch die Straßen Berlin und reichen sich das Symbol der kommunistischen Arbeiter*innenbewegung als Staffelstab in die Hand. In Joseph Beuys´ Porträt „La Rivoluzione Siamo Noi“ (1972) („Die Revolution sind wir“) ist der kollektive Akteur von da Volpedo auf das voranschreitende Künstlerindividuum zusammengeschrumpft. Wenn solche Bildwerdungen der Klassenfrage seltener geworden sind, muss das kein Grund zur Klage sein, beginnt doch die widerständige Haltung gegen den Klassencharakter der Kunst und seine Verleugnung ohnehin eher da, wo nicht nur die Klasse, sondern auch die Klassenbedingtheit von Produktion und Rezeption zum Thema gemacht wird.
Das geschieht mehr und mehr ab den 1960er Jahren. Der US-amerikanische Fotograf und Konzeptkünstler Allan Sekula hatte sich in Aerospace Folktales (1973) den Repräsentationen gewidmet, die über die Klassensubjekte existieren. Er beschreibt das hegemoniale Bild eines arbeitslos gewordenen Angestellten aus der Luftfahrtindustrie, der den Vorstellungen, die sich Managementliteratur und Wirtschaftsmagazine von Angestellten wie ihm machen, gerecht zu werden versucht. Über dieses Bild, die Repräsentation und ihren Einfluss auf die Praxis der Menschen, schreibt er im Kommentar zu den Fotos und den Interviews, die er von bzw. mit einem Ingenieur und seiner Frau – die Eltern des Künstlers – gemacht hat: „ich konnte dieses bild fotografieren“.11 Die Foto-Text-Arbeit von Sekula beschäftigt sich mit den Klassenerfahrungen und den daraus resultierenden Haltungen. Fast fünfzig Jahren später nutzt die Künstlerin Ariane Andereggen in ihrem gemeinsam mit dem Musiker Ted Gaier gemachten Film Klassenverhältnisse am Bodensee (2022) einen ganz ähnlichen Ansatz, der auch die soziale Herkunft der Künstlerin zum Ausgangspunkt für die Auseinandersetzungen über Bilder und Selbstbilder von Klassen nimmt. „Es gibt ein Bildungssystem“, erläutert die Stimme aus dem Off darin, „in dem die meisten ihre Rolle zu kennen scheinen, in dem ihr Instinkt ihnen sagt, wo sie hingehören“. Angestoßen durch die Lektüre Didier Eribons geht sie wie der Soziologe und wie schon Sekula als künstlerische Beobachterin in ihr Herkunftsmilieu und fragt nach ästhetischen Zugängen, nach der Produktion von Weltbildern.
Diese visuelle Produktion und Reproduktion von Klassenverhältnissen adressieren diese nicht nur in der Gesellschaft als ganze, sondern auch konkret im Hinblick auf den Spezial- und Spezialist*innenbereich der Kunst. Auch hier müssen die Erfahrungen anderer als der kunstbeflissenen Bürger*innen erst sichtbar gemacht und eingeklagt werden. Dabei hat sich gezeigt, dass die Arbeits- und Klassenverhältnisse auch noch von Geschlechterverhältnissen und solchen der Rassialisierung durchzogen sind. Auch diese differenten Erfahrungen müssen offengelegt, die Scheiben der Vitrinen müssen geputzt werden, wie die Künstlerin Mierle Laderman Ukeles in ihrer Maintenance Art-Serie (1969) deutlich machte. Sie säuberte die Museumseinrichtung und schrubbte den Ausstellungsboden, um die Alltagserfahrungen vieler Frauen* und die meist von Frauen* geleistete Reproduktionsarbeit sichtbar zu machen, ohne die die ästhetische Erfahrung gar nicht möglich wäre.
Feministische Künstler*innen und Theoretiker*innen haben spezifische Erfahrungen von anderen, in diesem Fall Frauen*, eingeklagt und sichtbar gemacht. Auch Künstler*innen und Theoretiker*innen, die anders als weiß rassialisiert werden, haben die westlich-weiße Matrix des Kunstfeldes als „Euroethnic art“ 12(Adrian Piper) angeprangert und ihre soziopolitischen und kulturellen Erfahrungen – nicht nur die der Diskriminierung und besonderen Ausbeutung – als relevant für die Produktion und Rezeption von Kunst erklärt. Diese häufig als identitätspolitisch gefassten Interventionen sind im Kunstfeld längst präsent und dass ihre Anerkennung im Diversitätskapitalismus auch marktmäßig Erfolg haben kann, macht ihre grundlegenden Anliegen nicht falsch. (Allerdings dürfen angesichts der Vielzahl von Ausstellungen, Texten in Kunstzeitschriften und Symposien der letzten vierzig Jahre zu im weitesten Sinne identitätspolitischen Fragen nicht die realen Machtverhältnisse im Kunstfeld außer acht gelassen werden, für die die Tatsache, dass etwa das Kunsthistorische Museum Wien in den mehr als 130 Jahren seines Bestehens noch immer keine Einzelausstellung einer Frau* gewidmet hat, geschweige denn einer indigenen oder Schwarzen oder trans Frau, nur ein kleiner Indikator ist.) Jedenfalls geriet die Klassenfrage dabei etwas in den Hintergrund, wobei der Bedeutungsgewinn der anderen identitätspolitischen Diskurse dafür bloß ein Grund unter mehreren – wie etwa der Bedeutungsverlust marxistischer Kunstsoziologie – ist. Ganz verschwunden war die Klassenfrage aber weder aus der Kunst (siehe Sekula und Andereggen), noch aus der Kunstsoziologie. In der Studie „Wir machen Kunst für Künstler“ von Franz Schultheis13 werden beispielsweise jene Akteur*innen befragt, die die handwerkliche Produktion von Kunst für namhafte Künstler*innen tatsächlich ausführen. Die bildende Kunst selbst gerät dabei als ein Arbeitsbereich in den Blick, in dem extreme Ungleichheiten herrschen, in dem viele beschäftigt sind aber nur wenige Prestige, Anerkennung und ökonomisches Kapital einheimsen.
Die Akteur*innen an den Rändern zu Wort kommen zu lassen und ihnen Gehör zu verschaffen, ist neben der Repräsentation von Klassenproduktionsweisen immer ein weiterer Schritt, um Ungleichheitsverhältnisse anzugreifen. Über die Möglichkeiten, das Sprechen der Subalternen vernehmbar zu machen, ist viel diskutiert worden.14 Bourdieu ist im Hinblick darauf, die mit der „Spezialistenkunst“ einhergehende Sprachlosigkeit der Nicht-Spezialist*innen überwinden und Worte hörbar machen zu können, die bislang nicht gehört oder verzerrt wahrgenommen wurden, wesentlich skeptischer als der ganze Berufsstand der Kunstvermittlung oder als Jürgen Habermas. Habermas hatte eine „Aneignung der Expertenkultur aus dem Blickwinkel der Lebenswelt“15 durchaus für möglich gehalten: Die Arbeiter, die sich in Peter Weiss’ Roman Ästhetik des Widerstands den Pergamon Altar nach ihren eigenen Maßstäben erschließen, sind ihm dafür ein paradigmatisches Beispiel. Die Interpretation vor dem Hintergrund einer „lebensgeschichtlichen Situation“16 ist eine andere als die des ästhetischen Blicks. Mit den Bedingungen, unter denen dieser Interpretation auch Geltung verliehen werden kann, beschäftigt sich Habermas allerdings nicht. Bourdieus Skeptizismus (der kein Determinismus ist) im Hinblick auf die Durchsetzung neuer Sichtweisen ist einerseits der Analyse der Voraussetzungen geschuldet, derer es bedarf, in Distinktions- und Anerkennungskämpfen neue Maßstäbe erfolgreiche durchzusetzen. Er rührt aber auch daher, dass der „Akt der Wortergreifung“ nicht nur im politischen Aktivismus, den Bourdieu in Bezug auf die Revolte von 1968 in Homo academicus thematisiert hatte, „immer ein Ergreifen der Worte der anderen ist oder vielmehr: ihres Schweigens“17 und damit auch ein Ausgrenzen und ein Beschweigen des Sprechens der anderen.
Um in diesem Abriss zur Klassenfrage in der bildenden Kunst wieder auf den Ausgangspunkt, den Text von Max Raphael, zurückzukommen: Raphael fügt schließlich der kunstsoziologischen und der ideologiekritischen noch eine politische Forderung hinzu. Die Frage ist nicht, ob die Arbeiter sich mit Kunst beschäftigen sollen, sondern wie. Dass sie es tun sollen, stellt Raphael gar nicht in Frage, trotz der Ausgrenzungen und der bis heute existierenden Segelklubexklusivität. Dass die Arbeiter*innen (und andere Marginalisierte) sich mit Kunst beschäftigen sollen, diese Position gründet sich bei Raphael und vielen anderen auf die Hoffnung auf Veränderung, die von der Beschäftigung mit Kunst ausgehen könnte. Die Auseinandersetzung mit Kunst innerhalb linker Gesellschaftstheorie ist voll von solchen Hoffnungen, die sich aus verschiedenen Aspekten speisen und unterschiedliche politische Strategien (für die und mit der Kunst) nach sich ziehen.18 Das Neulesen der Geschichte aus anderen als den hegemonialen Blickwinkeln, das Aufzeigen der „Bildungsverhältnisse“, die (Selbst-)Kritik am „Ergreifen der Worte der anderen“, das sind jedenfalls die integralen Bestandteile einer klassenkritischen Perspektive auf die bildende Kunst als Klassenkunst.
In einem Vortrag fragte sich der marxistische Kunsttheoretiker Max Raphael einst titelgebend: „Wie soll sich der Arbeiter mit Kunst beschäftigen?“ Sich diese Frage zu stellen, geht von der offenkundigen Annahme aus, dass die Antwort sich nicht von selbst versteht. Für den Bürger und die Bürgerin vielleicht, für die Arbeiter*innen anscheinend nicht. Es gibt da also etwas zu differenzieren, nämlich das Kunstpublikum. Diese Annahme ist begründet: Der Bürger habe die Vorstellung durchgesetzt, schreibt Raphael, „es gebe nur eine, seine Kunstbetrachtung und diese sei klassenlos, bedingungslos, ewig immer dieselbe“1. Raphael fordert damit eine soziologische und eine ideologiekritische Perspektive zugleich: Von kunstsoziologischer Warte aus wird die allzumenschliche Einheit der Kunstbetrachter*innen infrage gestellt. Die ideologiekritische Herangehensweise fragt danach, wie die Durchsetzung von Vorstellungen hergestellt wird, um sie schließlich zu kritisieren.
Vielleicht ist es in Zeiten von Van Gogh-Socken und virtueller Museumsrundgänge, von Warenästhetik und Kreativitätsimperativ kaum mehr nachvollziehbar, dass die bildende Kunst eine Klassenkunst ist, in ihrer Genese verknüpft mit gesellschaftlichen Spaltungen und den mit ihnen verbundenen Kämpfen um die Denk- und Wahrnehmungsweisen. Auch wenn wir es mehr und mehr mit einer „zentrifugale[n] Kunst“² zu tun haben, wie der Soziologe Andreas Reckwitz meint, in der sich Praktiken künstlerischer Produktions- und Rezeptionsweisen – von Formfragen bis zu lebensweltlichen Verhaltensweisen – auf andere, fast alle gesellschaftlichen Bereiche ausdehnen, sind nach wie vor nicht alle Rezeptions- und Umgangsweisen gleich legitim. Der „ästhetische Blick“, von Pierre Bourdieu als eine von allen Nützlichkeitskriterien gereinigte Art des Sehens beschrieben, ist doch nach wie vor ein wesentlicher Bestandteil, wenn nicht die dominant erforderte Disposition für die Kunstpraxis – Produktion wie Rezeption.³ Gereinigt von allen nicht-künstlerischen, also religiösen, moralischen, politischen u.a. Kriterien wurde die bildende Kunst erst mit der Etablierung der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaftsformen. Die Aneignung von Kunst verlief fortan anders als diejenige anderer kultureller Güter. Wie Raphael stellt auch Bourdieu heraus, dass dabei eine „partikulare Erfahrung in den Rang einer transhistorischen Norm jeder künstlerischen Wahrnehmung“⁴ erhoben wurde. Umgesetzt in Praxis wird diese Norm in jenem gesellschaftlichen Bereich, den Bourdieu dann als ein sich konsolidierendes Feld der Kunst beschreibt, in dem andere Bewertungskriterien herrschen als in der Landwirtschaft oder vor Gericht. Hier tobt sich sozusagen die „partikulare Erfahrung“ des Bürgertums aus, die nicht unbedingt jene von Arbeitern oder indigenen Frauen* ist. Das Feld der Kunst erscheint bis heute, wie der Kunsthistoriker Wolfgang Ullrich meint, häufig als noch „exklusiver als Segelklubs“.⁵ Rezipiert wird die bildende Kunst nicht von einer breiten Öffentlichkeit, sondern von relativ kleinen Zirkeln ausgewählter Kunstfeldangestellter, Sammler*innen und Galerist*innen. Trifft die zeitgenössische Kunst doch mal auf eine größere Menge an Leuten, dann handelt es sich dabei meist um relativ gebildete und auch finanziell nicht eben arme Menschen. Selbst bei Blockbuster-Ausstellungen mit Werken von Picasso oder Warhol handelt es sich, wie auch bei Kunstmessen, so Franz Schultheis u.a. in ihrer Studie zur Art Basel, um „praktisch rein ‚akademische’ Veranstaltungen“.⁶ Angehörige sogenannter unterer sozialer Milieus finden sich dort überhaupt nicht.
Norbert Elias konstatierte 1935 die Entwicklung einer Sphäre der Kunstproduktion und -rezeption, die mit den allgemeinen Geschmacksvorlieben kaum mehr zu vermitteln ist. Die moderne Kunst ist ein Teilbereich der Kultur und nicht der verständlichste. „Das Unverständnis der berufstätigen Gesellschaft für ihre Kunst ist symptomatisch nicht für die soziale Spannung zwischen verschiedenen berufstätigen Schichten, sondern für den Riß und die Spannung zwischen dem Geschmack der großen Spezialisten, der großen Kunst aller Art auf der einen Seite und dem Geschmack der Massengesellschaft, der Nichtspezialisten auf der anderen Seite“.⁷ Durchgesetzt hat sich diese „Spezialistenkunst“⁸ laut Elias, da ist Bourdieu mit ihm einig, mit Manet und den Impressionist*innen im Frankreich der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Schon Marx hatte schließlich den aus der Teilung der Arbeit „hervorgegangenen Bildungsverhältnissen“⁹ nachgesagt, entscheidend dafür zu sein, ob etwas als Kunst wahrgenommen wird bzw. werden kann oder nicht.
Wie schon angedeutet, gehen zumindest die hier zitierten Kunsttheoretiker davon aus, dass zur Durchsetzung der „Spezialistenkunst“ auch gehört, die Spezialisierung zu leugnen, die besonderen Voraussetzungen von Zeit, Muße und Interesse für Kunst in den Hintergrund zu rücken, also ihren Klassencharakter unsichtbar zu machen. Dagegen trat unter anderem die Kultursoziologie Bourdieus an, in der der darauf hingewiesen wurde, dass künstlerische Arbeiten „die am stärksten klassifizierenden und Klasse verleihenden“¹⁰ aller Konsumgüter sind. Sich mit Kunst zu beschäftigen, ist demnach nicht nur Ausdruck einer Klassenposition, sondern bestätigt und festigt diese auch. Aber nicht nur die Soziologie, auch Künstler*innen selbst ließen die Klassenfrage keineswegs undiskutiert und richteten ihr Tun nicht selten gegen die bürgerlichen Grundlagen ihres Schaffens. Die Geschichte der Avantgarden ließe sich ohne diesen anti-bürgerlichen Impetus gar nicht schreiben, der die Verbindungen zum Gros der Bevölkerung aber eher erschwert statt hergestellt hat. Daneben existierten immer auch Ansätze in der Tradition der Realismen, von Gustave Courbet über Bertolt Brecht bis zu dokumentarischen Arbeiten konzeptueller Künstler*innen der Gegenwart, die auf Repräsentation von Arbeit und Klasse abzielten und die verschiedenen Formen von Arbeits- und Klassenverhältnissen ins Werk zu setzen versuchten. So tritt die Arbeiterklasse als kollektives Subjekt ins Bild von Guiseppe da Volpedo („Der vierte Stand“, 1901), im sozialistischen Realismus der 1920er und 1930er Jahre, etwa bei Diego Rivera, gestaltet die Klasse die Zukunft, bevor sie dann um 1968 als Massenbasis fraglich wird – im Film „Farbtest. Die Rote Fahne“ (1968) von Gerd Conradt rennen nur noch einzelne durch die Straßen Berlin und reichen sich das Symbol der kommunistischen Arbeiter*innenbewegung als Staffelstab in die Hand. In Joseph Beuys´ Porträt „La Rivoluzione Siamo Noi“ (1972) („Die Revolution sind wir“) ist der kollektive Akteur von da Volpedo auf das voranschreitende Künstlerindividuum zusammengeschrumpft. Wenn solche Bildwerdungen der Klassenfrage seltener geworden sind, muss das kein Grund zur Klage sein, beginnt doch die widerständige Haltung gegen den Klassencharakter der Kunst und seine Verleugnung ohnehin eher da, wo nicht nur die Klasse, sondern auch die Klassenbedingtheit von Produktion und Rezeption zum Thema gemacht wird.
Das geschieht mehr und mehr ab den 1960er Jahren. Der US-amerikanische Fotograf und Konzeptkünstler Allan Sekula hatte sich in Aerospace Folktales (1973) den Repräsentationen gewidmet, die über die Klassensubjekte existieren. Er beschreibt das hegemoniale Bild eines arbeitslos gewordenen Angestellten aus der Luftfahrtindustrie, der den Vorstellungen, die sich Managementliteratur und Wirtschaftsmagazine von Angestellten wie ihm machen, gerecht zu werden versucht. Über dieses Bild, die Repräsentation und ihren Einfluss auf die Praxis der Menschen, schreibt er im Kommentar zu den Fotos und den Interviews, die er von bzw. mit einem Ingenieur und seiner Frau – die Eltern des Künstlers – gemacht hat: „ich konnte dieses bild fotografieren“.11 Die Foto-Text-Arbeit von Sekula beschäftigt sich mit den Klassenerfahrungen und den daraus resultierenden Haltungen. Fast fünfzig Jahren später nutzt die Künstlerin Ariane Andereggen in ihrem gemeinsam mit dem Musiker Ted Gaier gemachten Film Klassenverhältnisse am Bodensee (2022) einen ganz ähnlichen Ansatz, der auch die soziale Herkunft der Künstlerin zum Ausgangspunkt für die Auseinandersetzungen über Bilder und Selbstbilder von Klassen nimmt. „Es gibt ein Bildungssystem“, erläutert die Stimme aus dem Off darin, „in dem die meisten ihre Rolle zu kennen scheinen, in dem ihr Instinkt ihnen sagt, wo sie hingehören“. Angestoßen durch die Lektüre Didier Eribons geht sie wie der Soziologe und wie schon Sekula als künstlerische Beobachterin in ihr Herkunftsmilieu und fragt nach ästhetischen Zugängen, nach der Produktion von Weltbildern.
Diese visuelle Produktion und Reproduktion von Klassenverhältnissen adressieren diese nicht nur in der Gesellschaft als ganze, sondern auch konkret im Hinblick auf den Spezial- und Spezialist*innenbereich der Kunst. Auch hier müssen die Erfahrungen anderer als der kunstbeflissenen Bürger*innen erst sichtbar gemacht und eingeklagt werden. Dabei hat sich gezeigt, dass die Arbeits- und Klassenverhältnisse auch noch von Geschlechterverhältnissen und solchen der Rassialisierung durchzogen sind. Auch diese differenten Erfahrungen müssen offengelegt, die Scheiben der Vitrinen müssen geputzt werden, wie die Künstlerin Mierle Laderman Ukeles in ihrer Maintenance Art-Serie (1969) deutlich machte. Sie säuberte die Museumseinrichtung und schrubbte den Ausstellungsboden, um die Alltagserfahrungen vieler Frauen* und die meist von Frauen* geleistete Reproduktionsarbeit sichtbar zu machen, ohne die die ästhetische Erfahrung gar nicht möglich wäre.
Feministische Künstler*innen und Theoretiker*innen haben spezifische Erfahrungen von anderen, in diesem Fall Frauen*, eingeklagt und sichtbar gemacht. Auch Künstler*innen und Theoretiker*innen, die anders als weiß rassialisiert werden, haben die westlich-weiße Matrix des Kunstfeldes als „Euroethnic art“ 12(Adrian Piper) angeprangert und ihre soziopolitischen und kulturellen Erfahrungen – nicht nur die der Diskriminierung und besonderen Ausbeutung – als relevant für die Produktion und Rezeption von Kunst erklärt. Diese häufig als identitätspolitisch gefassten Interventionen sind im Kunstfeld längst präsent und dass ihre Anerkennung im Diversitätskapitalismus auch marktmäßig Erfolg haben kann, macht ihre grundlegenden Anliegen nicht falsch. (Allerdings dürfen angesichts der Vielzahl von Ausstellungen, Texten in Kunstzeitschriften und Symposien der letzten vierzig Jahre zu im weitesten Sinne identitätspolitischen Fragen nicht die realen Machtverhältnisse im Kunstfeld außer acht gelassen werden, für die die Tatsache, dass etwa das Kunsthistorische Museum Wien in den mehr als 130 Jahren seines Bestehens noch immer keine Einzelausstellung einer Frau* gewidmet hat, geschweige denn einer indigenen oder Schwarzen oder trans Frau, nur ein kleiner Indikator ist.) Jedenfalls geriet die Klassenfrage dabei etwas in den Hintergrund, wobei der Bedeutungsgewinn der anderen identitätspolitischen Diskurse dafür bloß ein Grund unter mehreren – wie etwa der Bedeutungsverlust marxistischer Kunstsoziologie – ist. Ganz verschwunden war die Klassenfrage aber weder aus der Kunst (siehe Sekula und Andereggen), noch aus der Kunstsoziologie. In der Studie „Wir machen Kunst für Künstler“ von Franz Schultheis13 werden beispielsweise jene Akteur*innen befragt, die die handwerkliche Produktion von Kunst für namhafte Künstler*innen tatsächlich ausführen. Die bildende Kunst selbst gerät dabei als ein Arbeitsbereich in den Blick, in dem extreme Ungleichheiten herrschen, in dem viele beschäftigt sind aber nur wenige Prestige, Anerkennung und ökonomisches Kapital einheimsen.
Die Akteur*innen an den Rändern zu Wort kommen zu lassen und ihnen Gehör zu verschaffen, ist neben der Repräsentation von Klassenproduktionsweisen immer ein weiterer Schritt, um Ungleichheitsverhältnisse anzugreifen. Über die Möglichkeiten, das Sprechen der Subalternen vernehmbar zu machen, ist viel diskutiert worden.14 Bourdieu ist im Hinblick darauf, die mit der „Spezialistenkunst“ einhergehende Sprachlosigkeit der Nicht-Spezialist*innen überwinden und Worte hörbar machen zu können, die bislang nicht gehört oder verzerrt wahrgenommen wurden, wesentlich skeptischer als der ganze Berufsstand der Kunstvermittlung oder als Jürgen Habermas. Habermas hatte eine „Aneignung der Expertenkultur aus dem Blickwinkel der Lebenswelt“15 durchaus für möglich gehalten: Die Arbeiter, die sich in Peter Weiss’ Roman Ästhetik des Widerstands den Pergamon Altar nach ihren eigenen Maßstäben erschließen, sind ihm dafür ein paradigmatisches Beispiel. Die Interpretation vor dem Hintergrund einer „lebensgeschichtlichen Situation“16 ist eine andere als die des ästhetischen Blicks. Mit den Bedingungen, unter denen dieser Interpretation auch Geltung verliehen werden kann, beschäftigt sich Habermas allerdings nicht. Bourdieus Skeptizismus (der kein Determinismus ist) im Hinblick auf die Durchsetzung neuer Sichtweisen ist einerseits der Analyse der Voraussetzungen geschuldet, derer es bedarf, in Distinktions- und Anerkennungskämpfen neue Maßstäbe erfolgreiche durchzusetzen. Er rührt aber auch daher, dass der „Akt der Wortergreifung“ nicht nur im politischen Aktivismus, den Bourdieu in Bezug auf die Revolte von 1968 in Homo academicus thematisiert hatte, „immer ein Ergreifen der Worte der anderen ist oder vielmehr: ihres Schweigens“17 und damit auch ein Ausgrenzen und ein Beschweigen des Sprechens der anderen.
Um in diesem Abriss zur Klassenfrage in der bildenden Kunst wieder auf den Ausgangspunkt, den Text von Max Raphael, zurückzukommen: Raphael fügt schließlich der kunstsoziologischen und der ideologiekritischen noch eine politische Forderung hinzu. Die Frage ist nicht, ob die Arbeiter sich mit Kunst beschäftigen sollen, sondern wie. Dass sie es tun sollen, stellt Raphael gar nicht in Frage, trotz der Ausgrenzungen und der bis heute existierenden Segelklubexklusivität. Dass die Arbeiter*innen (und andere Marginalisierte) sich mit Kunst beschäftigen sollen, diese Position gründet sich bei Raphael und vielen anderen auf die Hoffnung auf Veränderung, die von der Beschäftigung mit Kunst ausgehen könnte. Die Auseinandersetzung mit Kunst innerhalb linker Gesellschaftstheorie ist voll von solchen Hoffnungen, die sich aus verschiedenen Aspekten speisen und unterschiedliche politische Strategien (für die und mit der Kunst) nach sich ziehen.18 Das Neulesen der Geschichte aus anderen als den hegemonialen Blickwinkeln, das Aufzeigen der „Bildungsverhältnisse“, die (Selbst-)Kritik am „Ergreifen der Worte der anderen“, das sind jedenfalls die integralen Bestandteile einer klassenkritischen Perspektive auf die bildende Kunst als Klassenkunst.
1. Max Raphael: „Wie soll sich der Arbeiter mit Kunst beschäftigen?“ In: Ders.: Arbeiter, Kunst und Künstler. Dresden: Verlag der Kunst 1975, S. 5-69, hier S. 6.
2. Andreas Reckwitz: Die Erfindung der Kreativität. Zum Prozess gesellschaftlicher Ästhetisierung. Berlin: Suhrkamp Verlag 2012, S. 12.
3. Vgl. etwa Jens Kastner: Der Streit um den ästhetischen Blick. Kunst und Politik zwischen Pierre Bourdieu und Jacques Rancière. Wien: Verlag Turia + Kant 2012.
4. Pierre Bourdieu: „Die historische Genese der reinen Ästhetik“. In: Ders.: Kunst und Kultur. Kunst und künstlerisches Feld. Schriften zur Kultursoziologie 4. Herausgegeben von Franz Schultheis und Stephan Egger. Konstanz: UVK 2011, S. 289-307, hier S. 291.
5. Wolfgang Ullrich: Siegerkunst. Neuer Adel, teure Lust. Berlin: Wagenbach Verlag 2016, S. 73.
6. Franz Schultheis/ Erwin Single/ Stephan Egger/ Thomas Mazzurana: Kunst und Kapital. Begegnungen auf der Art Basel. Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König 2015, S. 130.
7. Norbert Elias: „Kitschstil und Kitschzeitalter“ [1935]. In: Ders.: Frühschriften. Bd. 1. Berlin: Suhrkamp Verlag 2002, S. 148-163, hier S. 157.
8. Ebd., S. 156.
9. Karl Marx: „Die Deutsche Ideologie“ [1845/46]. In: Ders.: Die Frühschriften. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag 2004, S. 405-554, hier S. 543.
10. Pierre Bourdieu: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt am Main 1987, S. 36.
11. Allan Sekula: „Aerospace Folktales (Geschichten von der Luftfahrt)“. In: Ders.: Performance Under Working Conditions. Aust.-Kat. Generali Foundation Wien, herausgegeben von Sabine Breitwieser, Wien: Generali Foundation 2003, S. 92-164, hier S.146.
12. Adrian Piper: „Power relations within existing Art Institutions”. In: Alexander Alberro und Blake Stimson (Hg.): Institutional Critique. An Anthology of Artists' Writings. Cambridge, MA/ London: MIT Press 2011, S. 246-274, hier S. 248.
13. Franz Schultheis: „Wir machen Kunst für Künstler“. Lohnarbeit in Kunstmanufakturen. Eine ethnographische Studie. Bielefeld: Transcript Verlag 2020.
14. In der Sozialtheorie ließe sich die Auseinandersetzung um diese Frage ausgehend von Antonio Gramsci über Ranajit Guha bis zu Gayatri Spivak und die jeweiligen Debatten um deren Konzepte nachzeichnen, vgl. zuletzt etwa Antonio Gramsci: Südfrage und Subalterne. Herausgegeben von Ingo Pohn-Lauggas und Alexandra Assinger. Hamburg: Argument Verlag 2023.
15. Jürgen Habermas: „Die Moderne – ein unvollendetes Projekt“ [1980]. In: Ders.: Die Moderne – ein unvollendetes Projekt. Philosophisch-politische Aufsätze 1977–1990. Leipzig: Reclam Verlag 1990, S. 32-54, hier S. 51.
16. Ebd., S. 50.
17. Pierre Bourdieu: Homo academicus. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 1992, S. 300.
18. Vgl. Jens Kastner: Die Linke und die Kunst. Ein Überblick. Münster: Unrast Verlag 2019.