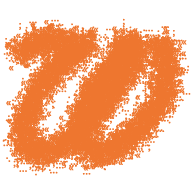Aidan Riebensahm, Ohne Worte - Eine transkulturelle Verbindung durch Raum und Zeit
Aidan Riebensahm, Ohne Worte
Aidan Riebensahm
Ohne Worte
Eine transkulturelle Verbindung durch Raum und Zeit
Ohne Worte
Eine transkulturelle Verbindung durch Raum und Zeit
|
„Ich weiß, dass meine
Perspektive so voreingenommen ist wie theirs, maybe more so, because I am personally invested. And yet it worries me, pains me, irks me that there ihre, vielleicht noch voreingenommener, weil ich persönlich betroffen bin. Und doch besorgt es mich, schmerzt es mich, stört es mich, dass es is barely an account of what it means to be of the in-between, what it means to be of Indian descent or part of beinahe keine Erzählung darüber gibt, was es heißt, zur indischen Community zu gehören oder zu the mixed-race class referred to as „Coloured“, which has never, of course, been mixed-race, and would protest der mixed-race Community, die als „Coloured“ bezeichnet wird, die aber natürlich niemals mixed-race gewesen ist und sich dagegen wehren würde to such a labeling, which of course can only occur from outside, which is another form of colonization of so gelabelt zu werden, so gelabelt zu werden, wie es nur von außen geschehen kann, was selbst nur eine andere Form der Kolonisierung von mind and body.“ |
|
|
Eine erste Erinnerung an eine Verbindung von Südniedersachsen nach Südafrika. Anfang der 90er Jahre. Eine Kindheit in Südniedersachsen. Ein Körper, für den Eltern unmögliche colour lines überschreiten. Conceived a crime. Born two months after the end of a regime. Eine Mutter erzählt zwei historische Ereignisse in einem Atemzug. Verschweigt die Umgebung. Von der Hand in den Mund wandern, im Rückblick verstehen. „Baseballschlägerjahre“, stolpern über einen Begriff, auf der Suche nach ganz anderen Fragen und Antworten. Nur eine Redewendung: Willkommen. Von Südafrika nach Südniedersachsen: Anrufe prasseln ein, berichten von verstorbenen Brüdern, Cousins, Onkeln. Nach Ende der Apartheid lauert die Gefahr noch hinter jeder Ecke, jedes Auto, jeder Windstoß könnte ein Zeichen sein. Ihre Herzen versagen. Wessen Blick ordnet ein, dass die Gefahr vorbei sei? Unsere Körper erinnern an die Gewalt, die Erzählungen kommen aus allen Richtungen, nur nicht von unten. Abwesende Berührungen von abwesenden Männern. Anrufe von Schwestern, Ehefrauen, Müttern, Töchtern – beerdigt wird am anderen Ende der Welt. Brüder, Ehemänner, Väter, Söhne dürfen jetzt beerdigt werden. Beileid am Telefon, Trauer in den Armen des eigenen Kindes. Rollenwechsel. Ich kenne die Grabsteine meiner Onkeln und Cousins nicht, ich wüsste von keinem Wort, das in meinem Namen in Stein gemeißelt ist. Von Südniedersachsen bis Südafrika: Wir sind nicht bei Trost. Ein Schwarzer Körper in feindlicher Umgebung lernt den Blick, der die Gefahr übersieht. Phänomenologie von Anstand und Stillsitzen. Obligatorische Besuche an Feiertagen. Verwandtschaft in der Nähe, auf Abstand. Objektifizierende Blicke werfen exotisierende Fantasien auf Kinder. Das Kind, wie die Fotos von braunen Kindern auf Reisen: gerettet von den guten Weißen. Assimilierung erzählen wir schweigend, denn hier sind gute, bürgerliche, weiße Kinder. Mit ihren eigenen Sorgen und eigenen Problemen. Normale Sorgen, normale Probleme. Psychische, physische und spirituelle Unversehrtheit aufgeben, um in Bildungs-, Religions- und Kulturinstitutionen still genug zu sitzen, um kulturelles Kapital anzuhäufen. Um die Aufgabe zu erfüllen. Glauben müssen an Lügen. Wissen, am anderen Ende der Welt wartet ein engmaschiges Netz aus Bluts- und Wahlverwandtschaft, die sich unterhalb staatlicher Gewalt zusammengefunden hat und bei seltenen Besuchen mit offenen Armen, gedeckten Tischen, warmen Worten und Gesten empfängt. Um die Distanz zu überwinden: führen Telefonate, schreiben Briefe, „Freunde“ auf sozialen Medien. Anstupsen. Hände erinnern, woran der Kopf nicht denken möchte: Einen Ausweg finden. Hände entkommen ordnenden und kategorisierenden Blicken bei scheinbar konformen Choreografien: schreiben, beten, klatschen, lesen. Hände greifen unterhalb der Blicklinie, nach anderen Händen, Körperteilen, Gegenständen - Hände suchen Berührung, Verführung und Trost. Mit der Schule ins Theater, Hände halten, eine Freundin an der Hand. Alle blicken auf die Bühne. Bachelorstudium der Kulturwissenschaften und ästhetischen Praxis bringt vermeintlich Licht ins Dunkel dieser Erfahrung. Theater: Ein Mann läuft durch einen Raum, ein anderer sieht ihm dabei zu. Handwerk Analyse zerlegt, erst zaghaft, dann selbstbewusst, aber ahnungslos die Elemente einer Aufführung. Beleuchtet sie von allen Seiten, schließt ein Fazit. Unsauber Theorien studieren, in denen die eigene Anwesenheit keine Rolle spielt. Literaturrecherche wird zur Spurensuche, auf den Fährten entlang der Krümel von anderen, die ihre vollgestopften Taschen großzügig entleerten. In Südniedersachsen an einem Bibliotheksregal lehnen, als wäre es sorgeberechtigt. Statt awkward am Telefon schweigen, schweigend einer Ahnung nachgehen. Gedruckte Worte in Zeilen von Zeichen ermutigen durch Raum und Zeit hinweg zur Suche nach Worten. Taktlos bleiben, entgegen jeder Projektion. Eine Arbeit schreiben, mit dem Gefühl, bei null anzusetzen. Diese Bewegung ist vertraut. Diese Bewegung fühlt sich an wie Stunden still sitzend mit einer Mutter im Wohnzimmer, das Häkeln lernen, einen Faden aufnehmen und ständig durch sich selbst hindurchziehen. Endlos, zu verwirrt vom impliziten Frau-sein dieser Tätigkeit. Analyse fühlt sich verboten an, als dürfte ich nicht genau hinschauen, aber meine Fingerspitzen bringen Worte zu Papier, für die meine Messer Zunge nie die Geduld hätte. Eine zweite Erinnerung an eine Verbindung nach Südafrika. Ich schreibe. Ein Abschluss, ein Aufstieg, eine eigene Spurensuche: Im Winter fliegen die Vögel in den Norden. Bachelor of Arts. Erste literarische Publikation. Eine Lesung. Simoné Goldschmidt-Lechner transformiert vom unbeleuchteten Publikumsmitglied zu Träger*in derselben Bürden. Wir greifen nach denselben, sich auflösenden Maschen. Wir schreiben uns ein in unsere unzähligen Erinnerungen an Distanz. Wir leben in einer Festung, ich versuche mich rauszuschreiben. Masterabschluss. Reimagining Gazes. Mein Körper erinnert sich an den Entzug von Bewegungs- und Ausdrucksfreiheit, die meinem eigenen Leben lange vorhergeht. Mein Körper erinnert sich an Konsequenzen, Repressionen oder Freiheitsentzug, die drohen, wenn er von den für mich vorgesehenen Wegen abweicht, und mein Körper erinnert sich an die Extase nach dem Überschreiten von Grenzen. Die innereuropäische Illusion von Kontakt- und Bewegungsfreiheit weicht einem strikten Reglement, das irgendwann wieder fallengelassen wird und das Zurückkehren eines Alltags behauptet, der immer noch zu viele Ausschlüsse bedingt. Diese Geschichte kommt mir vertraut vor. Erben von Diamantenminen vertreiben sich ihre Zeit in der Umlaufbahn unseres Planeten, während wir uns hier unten mit Wohnungslosigkeit, privatisiertem Wohnraum und Polizeigewalt herumschlagen, während an den Außengrenzen Europas Menschen ertrinken und unser Erdball in Flammen aufgeht. Fortwährend. Die Suche nach Worten für Trauer verschlägt mir die Sprache. Rhythmen, die nicht meine sind einen Wunsch Ich möchte mich einfach mal in einer Kontinuität fühlen. Der liminale Raum kennt mich. Hier sind alle Worst-Case-Szenarien schon eingetreten. Unbekannt ist hier nur: Ruhe. Meine Hände scrollen durch medialisierte Momentaufnahmen von Katastrophen, die sich über Jahrhunderte entwickelten. Die Eindrücke überschlagen sich. Nachdem meine Fingerspitzen keine Worte mehr in Tasten hämmern, wischen sie auf dem Touchdisplay meines Handys und berühren die Medialisierung des Endes einer Welt, einer Erzählung von Fortschritt, sie wischen über öffentliche Hinrichtungen, über Lippenbekenntnisse von Institutionen, denen ich kein Vertrauen schenken kann, meine Hände greifen nach Ablenkung und Beruhigung. Die Ressourcen und Zugänge, um diese Trauer in mein Lebensnarrativ einzuflechten, sind das große Privileg der ersten Generation, mit Zeit zum Trauern. Ich komme dem Schmerz, den ich mit mir herumschleppe, auf die Schliche. |
|
| „as though she had said, my mother was a ghost you know, and I will become one for you, I will haunt you gently, gently. Do not worry. Do not cry.“ Fragmentarische Antworten auf fragmentarische Fragen. Ich laufe nicht weiter, sondern blicke zurück. Hin und wieder in die Abgründe lunzen, die sich seit Beginn der Moderne aufgetan haben. Ich versuche zu verlernen, was mir im Durchschreiten aller Räume beigebracht wurde: Meinen Schmerz herunterspielen, negieren, ihn mit Hoffnung besänftigen oder Beweise suchen, weshalb ich ihn nicht spüren bräuchte. Ich atme in den Schmerz hinein und verstehe, dass er auch Teil meines ambivalenten Erbes ist. Meine Texte sind zu dicht, ich bin nicht bei Trost. Mit dem Wunsch, in mir anzukommen, greife ich zur Häkelnadel. Eine Nadel mit Haken, statt Spitze, ich ziehe Wolle durch Schlaufen, immer wieder und wieder. Ich wiege mich in einen Zustand, in dem aus dem Schmerz etwas Neues wird. Faden durch die Öse ziehen, erahnen einer Choreographie der Trauer, in der Hände, still, ein Anrecht auf Verletzlichkeit einfordern. Aktuelle Katastrophen, Verluste und Krisen verlangen mir ab, meine Performance eines rationalen, aufgeklärten, westlichen Subjekts abzulegen. Ich muss mich im Moment halten, ich nehme einen Faden auf, der fallen gelassen wurde oder sich hat fallen lassen, die Erzählungen sind widersprüchlich. Trotz Universitätsabschlüssen, immer wieder die Frage nach Überleben. Wie mit all den Verlusten, der Trauer, den Krisen und der mauen Perspektive auf alles zurechtkommen? Der Geist meiner Großmutter erscheint mir beim Häkeln. Sie lebte und starb am anderen Ende der Welt, am Kap der Guten Hoffnung. Wir begegneten uns nur zweimal. Von ihr weiß ich, trotz oder wegen all meiner Bildungszugänge, nur wenig. Die Distanz ist zu groß, sie ist gestorben, als ich noch sehr jung war. Ich weiß, dass sie ihren Frieden im Islam gesucht hat, zu dem sie konvertierte und damit den Spott ihrer christlichen Familie erntete. Ich weiß, dass ihr Glaube ihr Struktur und Halt bot. Ich weiß, dass sie umtriebig war, dass sie während ihres Lebens viele Liebhaber hatte. Und von den Erbstücken, die meine Tante in ihrem Haus hat, weiß ich, dass auch sie Halt im Anfertigen von Handarbeiten fand. Ich weiß, dass sie keine Mutter sein wollte, weiß, dass sie meine Mutter nicht großziehen konnte und ich weiß, dass ich der Generation angehöre, die Zeit finden muss, diese Trauer aufzuarbeiten. Als ich meine Großmutter mütterlicherseits im zweiten Coronawinter beschwöre, wendet sie mir den Rücken zu. Wir schweigen uns an und häkeln weiter. Dabei verwirren sich meine Gedanken, stellen Verbindungen zwischen meinem und ihrem Leben her, dem Leid, das wir bezeugen und den Fragen danach, wie ein Leben damit aussehen kann. Sie und ich sitzen einfach da und halten unsere Hände in Bewegung. Wir legen unsere Sprachen ab. Als mir die Tränen kommen, blickt sie nicht auf. Und ich beginne zu erzählen in einer Sprache, die sie nicht versteht. Aber sie hört, dass ihre Geschichte weitergeht. Vom Geist meiner Großmutter lerne ich, dass Trauern Handarbeit ist. Ich hoffe, sie lernt von mir, dass Heilung Beziehungsarbeit ist. Dass die Verknüpfungen, die wir herstellen, ineinander resonieren. Unsere Hände finden Ruhe von all der Arbeit, die sie leisten, um andere von unserem Mensch-sein zu überzeugen. |
|
|
Notizen |
Literatur
Goldschmidt-Lechner, Simoné: Messer, Zungen. Berlin: Matthes & Seitz 2022.
Goldschmidt-Lechner, Simoné: Messer, Zungen. Berlin: Matthes & Seitz 2022.