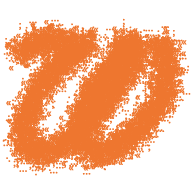Bafta Sarbo, Klasse und Klassismus
Bafta Sarbo, Klasse und Klassismus
Bafta Sarbo
Klasse und Klassismus
Klasse und Klassismus
|
Lange Zeit galt das Sprechen über Klasse und Klassengesellschaft als überholt, doch in den letzten Jahren können wir eine Wiederkehr in die Debatten beobachten. In der Soziologie und in öffentlichen Debatten schien es Konsens zu sein, dass ökonomische Klassenbeziehungen die sozialen Probleme der Gegenwart nicht erklären können. Der Kapitalismus gilt nicht nur als alternativlos, man glaubte lange, die damit verbundenen sozialen Probleme überwunden zu haben. In der neoliberalen Erzählung lag die Verantwortung für Armut im Familiären und Privaten und wurde weitestgehend auf das Individuum verlagert. Doch eine immer weiter wachsende Schere zwischen Arm und Reich, ein Anwachsen des prekären Sektors, unter anderem im Kontext der Agenda 2010, brachte die soziale Frage wieder auf. | |
|
Diese wird nun von unterschiedlichen Seiten aufgegriffen. Von rechts wurden Arbeiter*innen und Erwerbslose immer wieder als abgehängte und vergessene Gruppe in der Gesellschaft adressiert und zum Teil auch erfolgreich mobilisiert durch die PEGIDA-Demonstrationen um 2015 und die Wahlerfolge der AfD. Von linksliberaler Seite erleben wir eine neue Debatte um Klasse, die sich vor allem um den Begriff „Klassismus“ dreht. Das wurde in Deutschland auch angestoßen durch die Übersetzung von Didier Eribons Buch Rückkehr nach Reims Um zu verstehen, wieso die Debatte um Klassismus zu kurz greift und wir ohne einen fundierten Klassenbegriff nicht auskommen, lohnt es sich, die Klassentheorie des berühmtesten Klassentheoretikers, Karl Marx, wieder aufzuwärmen. |
|
|
Geschichte der Klassengesellschaft Klassengesellschaften sind nicht neu, auch wenn es sie nicht schon immer gab. Über die Geschichte hinweg gab es verschiedene Klassengesellschaften, in denen Klasse jeweils unterschiedlich organisiert war. Wenn wir uns zum Beispiel den Feudalismus anschauen, gab es Leibeigene, die Abgaben an Fürsten leisten mussten, entweder indem sie auf dem Feld des Fürsten arbeiteten oder, wenn sie Subistenzbauern*bäuerinnen waren, einen Teil ihrer Ernte abgaben. Die Aneignung des Mehrproduktes der Leibeigenen durch die Fürsten war Ausbeutung. Ausbeutung ist dabei keine Ausnahmeerscheinung, sondern der allgemeine Modus aller Klassengesellschaften. |
|
|
Im Kapitalismus funktionieren Klassen anders als in vorherigen Klassengesellschaften. Im Kapitalismus stehen sich zwei Klassen gegenüber, Arbeiter*innenklasse und Kapitalist*innenklasse. Das heißt nicht, dass es im Kapitalismus nicht noch andere Klassen gibt, sie spielen im Produktionsprozess nur eine untergeordnete Rolle. Arbeiter*innen sind im Kapitalismus besitzlos, das heißt, sie sind gezwungen, ihre Arbeitskraft wie eine Ware auf dem Markt zu verkaufen. Arbeiter*innen verkaufen somit ihre Arbeitskraft für einen begrenzten Zeitraum und nicht sich selbst. Dies müssen sie allerdings wieder und wieder tun. Dadurch, dass die Arbeit mit einem Lohn bezahlt wird, entsteht der Eindruck, man würde für seine Arbeit und nicht für die Arbeitskraft bezahlt werden. Es ist also nicht unmittelbar offensichtlich, dass es sich auch hier um ein auf Ausbeutung beruhendes Klassenverhältnis handelt und nicht um einen fairen Tausch. Der Lohn, den die Arbeiter*innen ausbezahlt bekommen, ist daher nicht die Auszahlung des Wertes, den sie produziert haben, sondern bemisst sich durchschnittlich durch das, was zur Reproduktion der Arbeitskraft nötig ist. Der Wert, der darüber hinaus erzeugt wird, der nicht in den Lohn eingeht, ist der Mehrwert, den sich Kapitalist*innen aneignen. Und dieser Mehrwert angehäuft wird zu Kapital. Obwohl Arbeiter*innen alle Waren produzieren, die wir täglich konsumieren, können sie darüber nicht verfügen. Sie bekommen lediglich einen Teil des Wertes als Lohn ausbezahlt. Kapitalistische Klassengesellschaft Das Spezifische an der kapitalistischen Lohnarbeit ist, dass sie kein unmittelbar persönliches Besitzverhältnis bezeichnet, wie es bei Sklaverei oder Leibeigenschaft der Fall war. Anders als in vorherigen Klassengesellschaften, in denen ein*e Sklave*Sklavin einen bestimmten Herren hat oder ein*e Leibeigene*r Abgaben an einen bestimmten Fürsten leisten muss, stehen sich hier keine individuellen Personen gegenüber, sondern unterschiedliche Klassen stehen in einem Verhältnis zueinander. Das heißt, die Besitzlosigkeit der Arbeiter*innen zwingt sie, in eine Abhängigkeit lohnarbeiten zu müssen. Diese Besitzlosigkeit musste historisch erst hergestellt werden, denn während im Feudalismus zum Beispiel Subistenzbauern*bäuerinnen existierten, die von dem Ertrag ihrer Ernte zumindest überleben konnten, wurden vor hunderten von Jahren bereits viele Bauern*Bäuerinnen von ihren Ländereien vertrieben und ehemaliges Gemeindeland in Privateigentum verwandelt. Global wurde dieser Prozess unter anderem durch den Kolonialismus ermöglicht, der damit die Form der kapitalistischen Klassengesellschaft globalisierte. Diese beruht auf der Trennung der Menschen, die Waren produzieren, von Land, Ressourcen und Arbeitsmitteln. Die Gesellschaft wird damit zunächst in zwei Klassen aufgeteilt: Menschen, die Produktionsmittel besitzen, und Menschen, die nichts besitzen. Damit ist Armut nicht einfach ein Resultat der Unterdrückung oder Diskriminierung der Arbeiter*innenklasse im Kapitalismus, sondern die Voraussetzung dafür, dass die Arbeiter*innenklasse als solche überhaupt existiert. Besitz von Kapital ist zwar ausschlaggebend, um zu definieren, wer zu welcher Klasse gehört, sollte aber nicht einfach als Besitz von Geld verstanden werden. Die immer neue Investition von Kapital sorgt auch dafür, dass dieses Klassenverhältnis sich innerhalb des Kapitalismus ständig reproduziert. So sehen wir auch, dass die politischen Interessen der Klassen nicht nur verschieden sind, sondern sich unmittelbar gegeneinander richten. Daraus ergibt sich die Logik des Klassenkampfes. Daraus ergibt sich allerdings nicht zwangsläufig eine Identifikation mit der eigenen Stellung in der Gesellschaft, denn insbesondere heutzutage ist es nicht mehr üblich, seine Identität über die Klassenzugehörigkeit zu definieren. Dieses Verschwinden eines Klassenbewussteins ist aber nicht gleichbedeutend mit dem Verschwinden der Klassen, denn an der Art, wie Reichtum angehäuft und verteilt wird, hat sich wenig geändert. Rassismus und Geschlecht im Kapitalismus Wie bereits erwähnt, entwickelten sich Klassengesellschaften bereits vor mehreren tausend Jahren. Auf der Grundlage der Arbeitsteilung zwischen Produktion und Reproduktion entstand das Patriarchat und die Frau wurde in die häusliche Sphäre verbannt. Diese Entwicklung spitzte sich mit der Konzentration von Privateigentum immer weiter zu. Die Frage, wie gesellschaftliche Reproduktion organisiert wird, ist auch heute noch zentral, denn die Arbeitskraft, mit der Kapital produziert wird, muss immer gewährleistet sein. Wenn wir uns die Gesellschaft anschauen, können wir sehen, dass genau diese reproduktiven Aufgaben, wie Kindererziehung und Hausarbeit (also Arbeiten, die die Aufrechterhaltung und ständige Zufuhr von Arbeitskraft gewährleisten), vergeschlechtlicht organisiert sind. Es sind vor allem Frauen, die diese Arbeit sowohl in der häuslichen Sphäre als auch in Form von Lohnarbeit leisten. Sie sind dabei in der Regel unter- oder unbezahlt, sowie in allgemein prekären Verhältnissen, die auch mit unsicheren Migrationsbedingungen verbunden sind. Die asymmetrischen Entwicklungsbedingungen unterschiedlicher Länder auf dem Weltmarkt infolge des Kolonialismus und der anhaltenden imperialistischen Ausbeutung sorgen auch für eine ungleiche Arbeitsteilung unterschiedlicher Länder auf dem Weltmarkt. Der Reichtum der kapitalistischen Warenproduktion, der global produziert wird, konzentriert sich vor allem in den industriellen Zentren wie Europa. In diesem Zusammenhang hat Rassismus innerhalb der globalen Produktionsverhältnisse, aber auch innerhalb von nationalen Kontexten, vor allem als Herrschaftsinstrument, die Funktion, mithilfe rassistischer Zuschreibungen Menschen gesellschaftliche Positionen zuzuweisen. Schwarze und braune Menschen gelten als körperlich belastbarer, und die Frauen darunter dazu noch als empathischer. Identitäten gelten als starr und werden als ein Abweichen von der Norm verstanden, insbesondere von der Geschlechternorm. So wird das Nicht-Identifizieren mit den zugeschriebenen Kategorien mit Ressentiments bestraft. Diese Abweichung gilt als besonders problematisch, weil sie damit vermeintlich oder real die Organisation der Gesellschaft in Frage stellt. Rassismus, Sexismus oder auch Queerfeindlichkeit können damit nicht einfach nur die Ausbeutung bestimmter Gruppen rechtfertigen, sondern auch bestimmten Teilen der Bevölkerung aufgrund ihrer vermeintlich natürlichen Eigenschaften einen Platz in der Gesellschaft zuteilen. Klassengesellschaft ist in dieser Ideologie nicht das Resultat eines geschichtlichen Prozesses, der auf Gewalt beruht, sondern schlicht Ausdruck menschlicher Natur. Klasse und Identität In den vergangenen Jahren wurden unter Ausdrücken wie „Klassenpolitik vs Identitätspolitk“ diese Themen gegeneinander ausgespielt. Es reicht dabei nicht aus, darauf zu bestehen, dass alles davon relevant ist, denn wichtig ist zu verstehen, wie diese Themen zueinander in Beziehung gesetzt werden. Klasse als weiteren Indentitätsmarker, neben Rassismus und Geschlecht aufzuzählen, wie es in Klassismusdebatten häufig der Fall ist, greift zu kurz. Klasse im Kontext von Arbeitsteilung und Eigentumsbeziehungen zu verstehen, bedeutet auch, dass wir sehen können, welches Potenzial feministische, queere und antirassistische Kämpfe im Kapitalismus haben. |
|
|
In diesem Sinne ist Klasse nicht einfach eine Identität mit einer kohärenten Erfahrungswelt. Klasse ist das gesellschaftliche Verhältnis, das die Produktion und Anhäufung von Kapital gewährleistet. Dass uns Klasse aber doch als Identität erscheint, liegt daran, wie Identitäten in der Moderne funktionieren. In der bürgerlichen Gesellschaft wird jede Tätigkeit in der Regel in Kategorien dargestellt, die so zu festen Eigenschaften von Menschen oder Gruppen gemacht werden. Das lässt sich gut an unterschiedlichen Identitäten verdeutlichen. Während zum Beispiel queere – das heißt in diesem Fall abweichende – Sexualität im europäischen Mittelalter noch mit Sodomie (etwas, das man macht) gleichgestellt wurde, wird sie heutzutage als Homosexualität (etwas, das man ist) gedacht. Diese Verdinglichung macht sich die Klassismusdebatte häufig zu eigen, indem sie versucht, aus der Klassenherkunft eine messbare Identität zu machen. Interessant ist, dass es dabei häufig nicht einmal wirklich um Arbeiter*innen an sich geht, sondern um sogenannte „Arbeiterkinder“ und die Differenz, die sie in der Konkurrenz zu anderen in ihrem Milieu erfahren, z.B. Akademiker*innen oder Künstler*innen, die im Gegensatz zu ihren Kolleg*innen nicht aus einem gebildeten kunstaffinen Milieu kommen. Die Frage, wieso die institutionalisierte Kunstwelt so weiß ist und wieso kaum Arbeiter*innenkinder darin vertreten sind, sind ein und dieselbe Frage: Es liegt ganz einfach daran, dass sie in ihrem Selbstverständnis bildungsbürgerlich ist. Kunst verstand sich lange als autonom, das heißt, als unabhängig von gesellschaftlichen Zwängen und äußeren Prinzipien. Durch kritische Bewegungen im 20. Jahrhundert, innerhalb und außerhalb der Kunst, wurde sichtbar gemacht, dass es so etwas wie klassenunabhängige Kunst und Kultur nicht gibt bzw. dass „klassenunabhängig“ implizit „bürgerlich“ bedeutet. In diesem Zusammenhang bedeutet „bürgerlich“ einmal die soziologisch bestimmte Gruppe, von der sie konsumiert wird, also das Publikum, aber auch Form und Inhalt des Kunstwerks. Der Anspruch unabhängiger Kunst in Europa entstand während der Zeit der Aufklärung, als das Bürgertum sich von der Herrschaft durch Adel und Klerus, später auch vom Staat emanzipieren wollte. Diese Klasse hat über die Jahrhunderte natürlich einen Wandel durchgemacht, aber im Prinzip lässt sie sich fassen als die privilegierten Klassen – diejenigen, die besitzen und damit nicht gezwungen sind, den gesellschaftlichen Reichtum zu produzieren. Geschichtlich ist die Kunst also bereits vor allem in dem bestimmten kulturell abgesteckten aber nicht völlig isolierten Milieu des Bürgertums beheimatet. |
|
|
Man müsste allerdings auch die Frage zurückwerfen, ob das überhaupt eine korrekte Frage oder eine adäquate Art ist, diesem Phänomen zu begegnen. In der Debatte arbeitet man häufig mit Bildern und plakativen Vorstellungen von Arbeiter*innen, oft männlich und im Industriesektor tätig, in jedem Fall jemand, der körperliche Arbeit verrichtet. Aber sind Künstler*innen selbst, insbesondere in der Freien Szene, nicht eine der am prekärsten lebenden Gruppen und von sozialer Verdrängung durch Gentrifizierung betroffen? Wenn in der Kunst- und Kulturlandschaft über Klasse gesprochen wird, dann häufig in Bezug auf die Diversität der Künstler*innen oder des Publikums. Versuche, Künstler*innen, Autor*innen oder das Publikum in diesem Sinne „diverser“ zu gestalten, offenbaren ein eher instrumentelles Verhältnis zu armen oder migrantischen Menschen. Da wird dann zwar die Zusammensetzung problematisiert und es wird versucht, die Gruppe „diverser“ zu machen, indem besondere Quoten eingeführt werden, aber genau da liegt häufig das Problem. Identitäten werden nicht als Teil sich verändernder Verhältnisse innerhalb der Klassengesellschaft verortet, sondern als eine doch statische Position des Unterdrücktseins dargestellt. Dieses verdinglichte Verständnis von Identitäten macht Menschen oder Gruppen häufig zum Gegenstand von Antidiskriminierungspolitik. Diese Logik machen sich auch andere gesellschaftliche Bereiche zu eigen. Anstatt dass wir uns kollektiv politisch organisieren und uns fragen, wie wir unser Zusammenleben anders und aktiv gestalten können, begreifen wir uns als unseren Verhältnissen und Identitäten ausgeliefert und formulieren unsere politischen Ziele als Forderungen an den Staat oder andere höhere Institutionen. Während also Forderungen nach Diversität in Bezug auf Klassenhintergrund an die Kunstwelt formuliert werden, bleibt das zugrunde liegende Verhältnis von Kapital und Arbeit verschleiert. So sind Kapitalist*in und Arbeiter*in nicht einfach Identitäten, die durch den Besitz oder nicht-Besitz von Geld bestimmt werden. Sie stehen vielmehr in einem Verhältnis zueinander, bei dem der Reichtum des einen durch die Armut und Enteignung des anderen begründet ist. Deshalb beendet Marx Das Kapital mit den Ausführungen zur sogenannten Ursprünglichen Akkumulation, die den historischen Vorgang beschreibt, bei dem die Arbeiter*innenklasse durch die systematische und gewaltsame Trennung von Produzent*innen von ihren Produktionsmitteln als solche erst hergestellt werden musste. Der relevante Aspekt ist hierbei, dass diese Eigentumslosigkeit der Arbeiter*innenklasse nicht nur Resultat sondern Voraussetzung dieses Verhältnisses zwischen Kapital und Arbeit ist. Brecht fasste das 1934 treffend zusammen: „Reicher Mann und armer Mann standen da und sah’n sich an. Und der arme sagte bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich.“ |
|
|
Daraus ergibt sich allerdings auch ein Potenzial für Kämpfe. Streik hat als Protestform ein besonderes Potenzial, weil die Tatsache, dass der Reichtum durch die Arbeiter*innenklasse produziert wird, auch bedeutet, dass sie eine spezifische Macht hat, um politische Forderungen durchzusetzen. So wird zum Beispiel den feministischen Protesten im Iran durch die Streiks der Arbeiter*innen eine besondere Schlagkraft verliehen. Schon 1973 waren es die Wilden Streiks der Gastarbeiter*innen, bei der migrantische und deutsche Arbeiter*innen in der Automobilindustrie die Gleichstellung der migrantischen mit den deutschen Arbeiter*innen forderten und gleichzeitig mehr Bezahlung für alle. 1978 war es der Streik der Arbeiter*innen in der Ölindustrie, die den Kämpfen gegen das Schahregime zum Erfolg verhalf. Anmerkung: Dieser Text ist eine Überarbeitung des Texts „Ein Potenzial für Klassenkämpfe“, der zu Beginn der Spielzeit auf der Website des HAU Hebbel am Ufer erschienen ist. |
|
|
Notizen |
Literatur
Atelierbeauftragter für Berlin: Basisdaten Bedarfserhebung Ateliersituation [Pressemitteilung], 12. Juni 2023, [Abruf am 31.01.2024.]
[Abruf am 31.01.2024.]
Eribon, Didier: Rückkehr nach Reims. Berlin: Suhrkamp 2016.
Foucault, Michel: Sexualität und Wahrheit. Erster Band: Der Wille zum Wissen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1987.
Marx, Karl: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. In: Marx-Engels-Werke (MEW), Bd. 23. Berlin: Dietz 1962.
Mohseni, Hamid: Iran: größte streikwelle seit 1979, in: www.rosalux.de, 23.05.2023, [Abruf am 25.01.2024.]
[Abruf am 25.01.2024.]
Atelierbeauftragter für Berlin: Basisdaten Bedarfserhebung Ateliersituation [Pressemitteilung], 12. Juni 2023,
Eribon, Didier: Rückkehr nach Reims. Berlin: Suhrkamp 2016.
Foucault, Michel: Sexualität und Wahrheit. Erster Band: Der Wille zum Wissen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1987.
Marx, Karl: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. In: Marx-Engels-Werke (MEW), Bd. 23. Berlin: Dietz 1962.
Mohseni, Hamid: Iran: größte streikwelle seit 1979, in: www.rosalux.de, 23.05.2023,