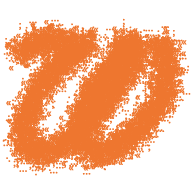Jens Kastner, Bildende Kunst als Klassenkunst
Jens Kastner, Bildende Kunst als Klassenkunst
Jens Kastner
Bildende Kunst als Klassenkunst
Bildende Kunst als Klassenkunst
| Der Klassencharakter gehört zur bildenden Kunst wie Öl auf Leinwand. Gemeinhin wird er unsichtbar gemacht, dagegen aber gibt es Widerstand. | |
|
In einem Vortrag fragte sich der marxistische Kunsttheoretiker Max Raphael einst titelgebend: „Wie soll sich der Arbeiter mit Kunst beschäftigen?“ Sich diese Frage zu stellen, geht von der offenkundigen Annahme aus, dass die Antwort sich nicht von selbst versteht. Für den*die Bürger*in vielleicht, für die Arbeiter*innen anscheinend nicht. Es gibt da also etwa zu differenzieren, nämlich das Kunstpublikum. Diese Annahme ist begründet: Der Bürger habe die Vorstellung durchgesetzt, schreibt Raphael, „es gebe nur eine, seine Kunstbetrachtung und diese sei klassenlos, bedingungslos, ewig immer dieselbe“. |
|
|
Vielleicht ist es in Zeiten von Van Gogh-Socken und virtueller Museumsrundgänge, von Warenästhetik und Kreativitätsimperativ kaum mehr nachvollziehbar, dass die bildende Kunst eine Klassenkunst ist, in ihrer Genese verknüpft mit gesellschaftlichen Spaltungen und den mit ihnen verbundenen Kämpfen um die Denk- und Wahrnehmungsweisen. Auch wenn wir es mehr und mehr mit einer „zentrifugale[n] Kunst“ |
|
|
Norbert Elias konstatierte 1935 die Entwicklung einer Sphäre der Kunstproduktion und -rezeption, die mit den allgemeinen Geschmacksvorlieben kaum mehr zu vermitteln ist. Die moderne Kunst ist ein Teilbereich der Kultur und nicht der verständlichste. „Das Unverständnis der berufstätigen Gesellschaft für ihre Kunst ist symptomatisch nicht für die soziale Spannung zwischen verschiedenen berufstätigen Schichten, sondern für den Riß und die Spannung zwischen dem Geschmack der großen Spezialisten, der großen Kunst aller Art auf der einen Seite und dem Geschmack der Massengesellschaft, der Nichtspezialisten auf der anderen Seite“. |
|
|
Wie schon angedeutet, gehen zumindest die hier zitierten Kunsttheoretiker davon aus, dass zur Durchsetzung der „Spezialistenkunst“ auch gehört, die Spezialisierung zu leugnen, die besonderen Voraussetzungen von Zeit, Muße und Interesse für Kunst in den Hintergrund zu rücken, also ihren Klassencharakter unsichtbar zu machen. Dagegen trat unter anderem die Kultursoziologie Bourdieus an, in der darauf hingewiesen wurde, dass künstlerische Arbeiten „die am stärksten klassifizierenden und Klasse verleihenden“ |
|
|
Das geschieht mehr und mehr ab den 1960er Jahren. Der US-amerikanische Fotograf und Konzeptkünstler Allan Sekula hatte sich in Aerospace Folktales (1973) den Repräsentationen gewidmet, die über die Klassensubjekte existieren. Er beschreibt das hegemoniale Bild eines arbeitslos gewordenen Angestellten aus der Luftfahrtindustrie, der den Vorstellungen, die sich Managementliteratur und Wirtschaftsmagazine von Angestellten wie ihm machen, gerecht zu werden versucht. Über dieses Bild, die Repräsentation und ihren Einfluss auf die Praxis der Menschen, schreibt er im Kommentar zu den Fotos und den Interviews, die er von bzw. mit einem Ingenieur und seiner Frau – die Eltern des Künstlers – gemacht hat: „ich konnte dieses bild fotografieren“. |
|
| Diese visuelle Produktion und Reproduktion von Klassenverhältnissen adressieren diese nicht nur in der Gesellschaft als ganze, sondern auch konkret im Hinblick auf den Spezial- und Spezialist*innenbereich der Kunst. Auch hier müssen die Erfahrungen anderer als der kunstbeflissenen Bürger*innen erst sichtbar gemacht und eingeklagt werden. Dabei hat sich gezeigt, dass die Arbeits- und Klassenverhältnisse auch noch von Geschlechterverhältnissen und solchen der Rassialisierung durchzogen sind. Auch diese differenten Erfahrungen müssen offengelegt, die Scheiben der Vitrinen müssen geputzt werden, wie die Künstlerin Mierle Laderman Ukeles in ihrer Maintenance Art-Serie (1969) deutlich machte. Sie säuberte die Museumseinrichtung und schrubbte den Ausstellungsboden, um die Alltagserfahrungen vieler Frauen* und die meist von Frauen* geleistete Reproduktionsarbeit sichtbar zu machen, ohne die die ästhetische Erfahrung gar nicht möglich wäre. | |
|
Feministische Künstler*innen und Theoretiker*innen haben spezifische Erfahrungen von anderen, in diesem Fall Frauen*, eingeklagt und sichtbar gemacht. Auch Künstler*innen und Theoretiker*innen, die anders als weiß rassialisiert werden, haben die westlich-weiße Matrix des Kunstfeldes als „Euroethnic art“ |
|
|
Die Akteur*innen an den Rändern zu Wort kommen zu lassen und ihnen Gehör zu verschaffen, ist neben der Repräsentation von Klassenproduktionsweisen immer ein weiterer Schritt, um Ungleichheitsverhältnisse anzugreifen. Über die Möglichkeiten, das Sprechen der Subalternen vernehmbar zu machen, ist viel diskutiert worden. Bourdieus Skeptizismus (der kein Determinismus ist) im Hinblick auf die Durchsetzung neuer Sichtweisen ist einerseits der Analyse der Voraussetzungen geschuldet, derer es bedarf, in Distinktions- und Anerkennungskämpfen neue Maßstäbe erfolgreich durchzusetzen. Er rührt aber auch daher, dass der „Akt der Wortergreifung“ nicht nur im politischen Aktivismus, den Bourdieu in Bezug auf die Revolte von 1968 in Homo academicus thematisiert hatte, „immer ein Ergreifen der Worte der anderen ist oder vielmehr: ihres Schweigens“ |
|
|
Um in diesem Abriss zur Klassenfrage in der bildenden Kunst wieder auf den Ausgangspunkt, den Text von Max Raphael, zurückzukommen: Raphael fügt schließlich der kunstsoziologischen und der ideologiekritischen noch eine politische Forderung hinzu. Die Frage ist nicht, ob die Arbeiter sich mit Kunst beschäftigen sollen, sondern wie. Dass sie es tun sollen, stellt Raphael gar nicht in Frage, trotz der Ausgrenzungen und der bis heute existierenden Segelklubexklusivität. Dass die Arbeiter*innen (und andere Marginalisierte) sich mit Kunst beschäftigen sollen, diese Position gründet sich bei Raphael und vielen anderen auf die Hoffnung auf Veränderung, die von der Beschäftigung mit Kunst ausgehen könnte. Die Auseinandersetzung mit Kunst innerhalb linker Gesellschaftstheorie ist voll von solchen Hoffnungen, die sich aus verschiedenen Aspekten speisen und unterschiedliche politische Strategien (für die und mit der Kunst) nach sich ziehen. |
|
|
Notizen |
Literatur
Bourdieu, Pierre: Homo academicus. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 1992.
Bourdieu, Pierre: „Die historische Genese der reinen Ästhetik“, in: Bourdieu, Pierre: Kunst und Kultur. Kunst und künstlerisches Feld. Schriften zur Kultursoziologie 4. Herausgegeben von Franz Schultheis und Stephan Egger. Konstanz: UVK 2011.
Bourdieu, Pierre: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt am Main 1987.
Elias, Norbert: „Kitschstil und Kitschzeitalter“ [1935], in: Elias, Norbert: Frühschriften. Bd. 1. Berlin: Suhrkamp Verlag 2002.
Gramsci, Antonio: Südfrage und Subalterne. Herausgegeben von Ingo Pohn-Lauggas und Alexandra Assinger. Hamburg: Argument Verlag 2023.
Habermas, Jürgen: „Die Moderne – ein unvollendetes Projekt“ [1980], in: Habermas, Jürgen: Die Moderne – ein unvollendetes Projekt. Philosophisch-politische Aufsätze 1977–1990. Leipzig: Reclam Verlag 1990.
Kastner, Jens: Die Linke und die Kunst. Ein Überblick. Münster: Unrast Verlag 2019.
Kastner, Jens: Der Streit um den ästhetischen Blick. Kunst und Politik zwischen Pierre Bourdieu und Jacques Rancière. Wien: Verlag Turia + Kant 2012.
Marx, Karl: „Die Deutsche Ideologie“ [1845/46], in: Marx, Karl: Die Frühschriften. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag 2004.
Piper, Adrian: „Power Relations within Existing Art Institutions“, in: Alberro, Alexander / Stimson, Blake (Hg.): Institutional Critique. An Anthology of Artists’ Writings. Cambridge, MA/ London: MIT Press 2011.
Raphael, Max: „Wie soll sich der Arbeiter mit Kunst beschäftigen?“, in: Raphael, Max (Hrsg.): Arbeiter, Kunst und Künstler. Dresden: Verlag der Kunst 1975.
Reckwitz, Andreas: Die Erfindung der Kreativität. Zum Prozess gesellschaftlicher Ästhetisierung. Berlin: Suhrkamp Verlag 2012.
Schultheis, Franz / Single, Erwin / Egger, Stephan / Mazzurana, Thomas: Kunst und Kapital. Begegnungen auf der Art Basel. Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König 2015.
Schultheis, Franz: „Wir machen Kunst für Künstler“. Lohnarbeit in Kunstmanufakturen. Eine ethnographische Studie. Bielefeld: transcript Verlag 2020.
Sekula, Allan: „Aerospace Folktales (Geschichten von der Luftfahrt)“, in: Sekula, Allan: Performance Under Working Conditions. Aust.-Kat. Generali Foundation Wien, herausgegeben von Sabine Breitwieser, Wien: Generali Foundation 2003.
Ullrich, Wolfgang: Siegerkunst. Neuer Adel, teure Lust. Berlin: Wagenbach Verlag 2016.
Bourdieu, Pierre: Homo academicus. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 1992.
Bourdieu, Pierre: „Die historische Genese der reinen Ästhetik“, in: Bourdieu, Pierre: Kunst und Kultur. Kunst und künstlerisches Feld. Schriften zur Kultursoziologie 4. Herausgegeben von Franz Schultheis und Stephan Egger. Konstanz: UVK 2011.
Bourdieu, Pierre: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt am Main 1987.
Elias, Norbert: „Kitschstil und Kitschzeitalter“ [1935], in: Elias, Norbert: Frühschriften. Bd. 1. Berlin: Suhrkamp Verlag 2002.
Gramsci, Antonio: Südfrage und Subalterne. Herausgegeben von Ingo Pohn-Lauggas und Alexandra Assinger. Hamburg: Argument Verlag 2023.
Habermas, Jürgen: „Die Moderne – ein unvollendetes Projekt“ [1980], in: Habermas, Jürgen: Die Moderne – ein unvollendetes Projekt. Philosophisch-politische Aufsätze 1977–1990. Leipzig: Reclam Verlag 1990.
Kastner, Jens: Die Linke und die Kunst. Ein Überblick. Münster: Unrast Verlag 2019.
Kastner, Jens: Der Streit um den ästhetischen Blick. Kunst und Politik zwischen Pierre Bourdieu und Jacques Rancière. Wien: Verlag Turia + Kant 2012.
Marx, Karl: „Die Deutsche Ideologie“ [1845/46], in: Marx, Karl: Die Frühschriften. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag 2004.
Piper, Adrian: „Power Relations within Existing Art Institutions“, in: Alberro, Alexander / Stimson, Blake (Hg.): Institutional Critique. An Anthology of Artists’ Writings. Cambridge, MA/ London: MIT Press 2011.
Raphael, Max: „Wie soll sich der Arbeiter mit Kunst beschäftigen?“, in: Raphael, Max (Hrsg.): Arbeiter, Kunst und Künstler. Dresden: Verlag der Kunst 1975.
Reckwitz, Andreas: Die Erfindung der Kreativität. Zum Prozess gesellschaftlicher Ästhetisierung. Berlin: Suhrkamp Verlag 2012.
Schultheis, Franz / Single, Erwin / Egger, Stephan / Mazzurana, Thomas: Kunst und Kapital. Begegnungen auf der Art Basel. Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König 2015.
Schultheis, Franz: „Wir machen Kunst für Künstler“. Lohnarbeit in Kunstmanufakturen. Eine ethnographische Studie. Bielefeld: transcript Verlag 2020.
Sekula, Allan: „Aerospace Folktales (Geschichten von der Luftfahrt)“, in: Sekula, Allan: Performance Under Working Conditions. Aust.-Kat. Generali Foundation Wien, herausgegeben von Sabine Breitwieser, Wien: Generali Foundation 2003.
Ullrich, Wolfgang: Siegerkunst. Neuer Adel, teure Lust. Berlin: Wagenbach Verlag 2016.