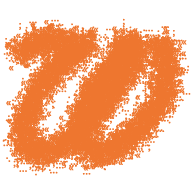Die Frage, die uns seit einigen Jahren an der Schnittstelle zwischen Institutionen, zivilgesellschaftlichen Akteur*innen und Mehrheitsgesellschaft umtreibt, ist, warum die Programme zu Diversität eigentlich immer so gut klingen und so häufig nicht funktionieren. Und warum diejenigen, die rassismussensible Formate umsetzen, stets als freie Akteur*innen auf Projektbasis oder auf befristeten Schleudersitzen agieren müssen. Dort, wo sie immer wieder leitenden Personen ausgesetzt sind, die von Rassismus und anderen Formen der Ausgrenzung profitiert haben und sich deswegen nur bis zu einem gewissen Grad kritisch hinterfragen können und wollen. Es gibt keine Strukturen der Beschwerde und nicht genügend Führungspersönlichkeiten in Kunst- und Kulturinstitutionen, die es anders machen. Noch nicht.
Warum schaffen es die Institutionen nicht, diverse und inklusive Belegschaften vorzuweisen? Der Grund ist unter anderem, dass das Aufzeigen von Leerstellen, fehlender Sensibilisierung und der Unabdingbarkeit von Transformation auf defizitäre Ist-Zustände verweist. Auf vielen Ebenen und in unterschiedlichen Bereichen wird das Aufzeigen von Missständen entweder als bedenkenswürdiger oder unpassender Akt des Ungehorsams interpretiert oder als Bedrohung im Sinne eines vom-Sockel-stürzen-Wollens wahrgenommen. Die Erkenntnis darüber, dass die meist zeitlich begrenzten und häufig vereinzelten „Diversifizierungsprojekte“ bisher nicht mehr als „Öffnungsphantasien“ sind, lösen bei den Personen, die vom Ausschluss bisheriger Diskursträger*innen profitiert haben, Gefühle von Kontrollverlust aus. Künstler*innen, Mitarbeiter*innen und Akteur*innen, deren Präsenzen von der Dominanzgesellschaft als unkonventionell wahrgenommen und deren Ambitionen – falls abgefragt – als unverhältnismäßig bewertet werden, bezeugen diese Abläufe täglich.
Bürgerliche Institutionen kennen ihre Bürger*innen nicht mehr, sonst wären sie nicht so pietätlos gegenüber den doch hinlänglich bekannten Erfahrungen und der Geschichte der Gewalt und Unterdrückung. Wieso ist es nicht möglich, diesen Geschichten einen Raum in den Museen, Theatern und Literaturhäusern dieses Landes zu geben – und damit ihre Existenz anzuerkennen? Wir brauchen eine neue Auseinandersetzung mit der Erinnerungskultur dieses Landes, die ernsthaft gewillt ist, Kolonialismus, die Ära der Gastarbeit und postnationalsozialistische Kontinuitäten als Teil davon anzuerkennen. Wir brauchen neue Ansätze in der Beschäftigung mit den Künsten und den Sammlungen, die Erfahrungen von Rassismus, Klassismus und anderen Formen der Demütigung und Benachteiligung reflektieren. Wir brauchen gesellschaftlich relevante Plattformen, in denen Fragen kultureller Wiedergutmachung tatsächlich diskutiert und mit Konsequenzen verhandelt werden. Und wir brauchen vor allem neue Akteur*innen, die die Geschichten und die Realitäten derer kennen, deren Geschichten sie erzählen wollen.
Denn in den Institutionen mangelt es nicht an dem Bewusstsein ihres Potenzials für eine offene Gesellschaft. Als Orte des kollektiven Gedächtnisses und damit Produktionsort imaginierter Communities könnten sie neue Grundlagen für das Zusammenleben in einer pluralen Welt schaffen. Dafür müssten die kollektiven Erfahrungen und vielfältigen Lebensrealitäten der Bevölkerung allerdings radikal anders anerkannt und vor allem von denen (re-)präsentiert werden, die es wirklich wissen. In den Häusern ist die Erkenntnis, dass das mehr benötigt als nur ein Wohlwollen gegenüber Mitgestaltung und Teilhabe, jedoch schnell mit Ängsten um den eigenen Status Quo verbunden. White Fragility hat viele Gesichter – und unglaublich viele Nuancen. Leider gibt es noch nicht einmal annähernd so viel kritisches Wissen zu White Fragility wie es Diversitätsprojekte”, bzw. Maßnahmen für „kunstschaffende Ausländer*innen“ gibt.
Worum geht es, wenn Anläufe der neuen Expert*innen hin zu einer klassismussensiblen und antirassistischen Arbeit aussortiert werden und als diffuse, nicht leistbare – zu politische – Mehrarbeit kategorisiert werden?
Es geht darum, dass das Wissen von nicht-akademisierten oder Akteur*innen bisher nicht beachteter Communities dem der bestehenden Institutionsmitarbeiter*innen gleichgestellt und entsprechend berücksichtigt und kommuniziert wird. Es geht darum, dass ihr Wissen respektvoll behandelt und ihre Arbeit und ihre Projekte angemessen vergütet und finanziell ausgestattet sind. Angemessen bedeutet dabei: gemessen an den restlichen Aufwendungen der Häuser. Denn es wird in den vorhandenen Partizipationsprogrammen neben dem, was „gemeinsam“ entwickelt wird, um nichts weniger als um gesellschaftliche Realitäten gerungen. Personen, die von den Institutionen dazu eingeladen werden, ihre Ausstellungen, Veranstaltungen oder sogar Strukturen mitzugestalten, geht es oft um Anerkennung und Teilhabe – und damit um gesellschaftliche und kulturelle Gleichberechtigung. Im Vergleich dazu geht es den Institutionen viel banaler um die Erhöhung der gesellschaftlichen Akzeptanz und Relevanz einzelner Akteur*innen und ihrer oft familiär verbundenen Karrieren.
Deswegen werden diese politischen Dimensionen von Diversitätsarbeit immer wieder bewusst ausgeklammert und diejenigen dafür ausgesucht, die sich möglichst wenig mit Fragen kultureller Gleichberechtigung und kultureller Gerechtigkeit beschäftigen wollen oder können. Und bei finanziellen Engpässen werden oft die Formate als erstes gestrichen, an denen sich BIPoC beteiligt haben oder beteiligen sollten. Dabei reichen die Angebote von BIPoC Fokusgruppen bei Besucher*innenbefragungen, Vermittlungsangeboten ausschließlich für BIPoC, Veranstaltungskooperationen mit Migrant*innenselbstorganisationen bis zu divers besetzten Beratungsgremien wie Critical Friends, Think Tanks und Beiräten, die die Arbeit der Institutionen diskriminierungskritisch begleiten sollen. All das sind richtige und wichtige Initiativen und Projekte. Die meisten von uns haben in ihrem Leben bereits viel Zeit damit verbracht, diese Projekte zu bezeugen, zu initiieren oder durchzuführen. Vielleicht würden wir heute einige davon nicht mehr so machen, den erlebten Klassismus und Rassismus vielleicht nicht nochmal so kommentarlos hinnehmen. Aber dieser Lernprozess braucht Zeit, kollektive Prozesse und viel Liebe für sich selbst.
Es geht also nicht nur um Projekte, sondern um Repräsentations- und Verteilungskämpfe. Oder anders formuliert: Ein Partizipationsangebot an marginalisierte Gruppen ist mit Wünschen, Hoffnungen und einem Versprechen verbunden, das über die partizipativen Projekte an sich hinausweist. Drehen wir die Perspektive nämlich einmal um und fragen uns, welche Gründe migrantisierte, Schwarze Personen und Personen of Color überhaupt haben könnten, die institutionellen Angebote anzunehmen? Welches Interesse könnten sie daran haben, an der Gestaltung der Kulturinstitutionen „mitzuwirken“, die sie und ihre Lebenswelten in den meisten Fällen jahre- und jahrzehntelang ignoriert haben?
|
Nehmen wir als Beispiel die mittlerweile an vielen Orten durchgeführten Sammlungsprojekte, bei denen Museen versuchen, ihre Sammlungen um Objekte zu ergänzen, die die jeweils urbane Migrationsgeschichte und das Thema Rassismus erzählen. Ruft das Museum als – historisch gesehen – „Ort der nationalen und kulturellen Identitätsstiftung und Selbstvergewisserung“  zu so etwas auf, klingt es von außen so, als könne Migrationsgeschichte, Antirassismus, gar Restitution und klassismussensible Personalführung nun Teil des institutionellen Selbstverständnisses werden. Am Horizont erscheint also – bewusst oder unbewusst – die Möglichkeit, die Gelegenheit zu bekommen, sich mit den eigenen Lebenswelten, – realitäten und -geschichten in eine nationale Erzählung einschreiben zu können. zu so etwas auf, klingt es von außen so, als könne Migrationsgeschichte, Antirassismus, gar Restitution und klassismussensible Personalführung nun Teil des institutionellen Selbstverständnisses werden. Am Horizont erscheint also – bewusst oder unbewusst – die Möglichkeit, die Gelegenheit zu bekommen, sich mit den eigenen Lebenswelten, – realitäten und -geschichten in eine nationale Erzählung einschreiben zu können.
Folglich steht das Partizipationsangebot mit Kämpfen um gesellschaftliche Teilhabe und Anerkennung in Verbindung, die mindestens ein halbes Jahrhundert alt sind. Und um das irgendwie übergeordnete Ziel von Teilhabe und Anerkennung zu erreichen, gehen Expert*innen auch immer wieder das Risiko ein, auf Angebote einzugehen. Entweder, weil der Spatz besser ist als die Taube auf dem Dach oder weil das Überleben eine Win-Win Situation ist und ein Stück vom Kuchen besser ist als keiner – oder weil die Angebote – wenn auch nicht das Ziel – so doch wenigstens Etappensiege auf dem Weg zu etwas mehr Kulturgerechtigkeit versprechen. Versprechen haben etwas mit Vertrauen zu tun. Doch wie vertrauen, ohne loyales Gegenüber?
Denn oft wird die Hoffnung im Laufe der Zusammenarbeit trotzdem enttäuscht, weil klar wird, dass die mit einer vollwertigen Teilhabe verbundenen grundlegenden Veränderungen des Museums und des Theaters – also zum Beispiel eine perspektivisch diverse Personal- und Publikumsstruktur oder eine grundlegend globale Geschichtserzählung in den Ausstellungen und Aufführungen – dann doch nicht wirklich das Ziel der Häuser und „irgendwie auch nie so gemeint“ waren. Schauen Sie sich doch die Panels der Kulturpolitik und der Institutionen an.
Laurel Chokoago, eine Schwarze Künstlerin aus Hamburg, hat es in ihrer Arbeit für die Ausstellung Hey Hamburg, kennst Du Duala Manga Bell?, in der es um die deutsch-kamerunische Kolonialgeschichte geht, sehr gut auf den Punkt gebracht. Ihre Arbeit zeigt das Foto eines Plastik-Gartenstuhls, der auf eine transparente, verformte Plexiglasscheibe aufgedruckt wurde – und trägt den deutlich durchgestrichenen Titel A Seat at the Table.
|
Für BIPoC gestaltet sich der Prozess schmerzhaft und frustrierend, weil sich in der Zurückweisung durch die Institutionen gesellschaftlich schmerzhafte Erfahrungen wiederholen, wenn sie am Ende der Projekte gefühlt „aus dem System wieder aus[ge]spuckt“  werden und die Institutionen in ihren Arbeitsstrukturen und -verfahren gesamtgesellschaftliche Ausgrenzungsdynamiken verfestigen. werden und die Institutionen in ihren Arbeitsstrukturen und -verfahren gesamtgesellschaftliche Ausgrenzungsdynamiken verfestigen.
Für die Personen, die die Öffnungsprozesse aus den Institutionen heraus steuern sollen – wie zum Beispiel die 360° Agent*innen – die bevorzugt selbst Marginalisierungserfahrungen mitbringen sollten – gestaltet sich der Prozess ebenfalls schmerzhaft, wenn auch anders. Als designierte Mittler*innen versuchten sie häufig, das Bindeglied zwischen den institutionellen Bedarfen und den Forderungen der marginalisierten Zielgruppen zu sein und die Lücke zwischen dem Wunsch nach Relevanz und dem Wunsch nach gesellschaftlicher Teilhabe zu füllen: Sie agierten in zwei Richtungen. Zum einen versuchten sie die Institutionen dazu zu bewegen, sich über den Wunsch nach erhöhter gesellschaftlicher Relevanz hinaus in einen tatsächlich grundlegenden, transformatorischen Prozess zu begeben und die dafür notwendigen Maßnahmen und strukurellen Veränderungen anzugehen. Zum anderen versuchten sie, die Türen in Richtung der marginalisierten Communities zu öffnen und offen zu halten, um ihnen zu ermöglichen, ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten auszuloten. Aber auch sie sind größtenteils enttäuscht und frustriert – oder auch einfach nur erschöpft, weil sich herausstellt, dass es in zahlreichen Institutionen gar keinen Willen zu einer grundsätzlichen Veränderung der Strukturen gibt.
Aufseiten der Institutionen führt das fehlende Bewusstsein dafür, dass es für eine diverse und friedliche Gesellschaft vor dem Hintergrund ihrer alltäglichen Erfahrungen eben nicht egal sein kann, ob langjährige Mitarbeiter*innen das N-Wort verwenden dürfen, weil sie nunmal seit zehn Jahren beliebt und im Betriebsrat sind und es keine Beschwerdestrukturen für prekär Beschäftigte gibt. Es ist nicht egal, dass der Glaube daran, dass von Rassismus betroffene Personen diejenigen sein müssen, die sich gegen Rassismus einsetzen, weil der Rest schweigt. Es ist nicht egal, dass Empowerment-Workshops immer noch von internen Strukturen erbeten werden müssen – und nicht eine Selbstverständlichkeit sind. Es ist nicht egal, dass es dafür keine übergeordneten Strukturen und gelebten Regelwerke gibt. Und es ist auch nicht egal, dass die Sensibilisierung für die ökonomischen Rahmenbedingungen marginalisierter Akteur*innen der Stadtgesellschaft in den meisten Institutionen noch nicht einmal in Planung ist.
Anders wird das allerdings nur, wenn sich Leitungspersonen darüber im Klaren sind und aktiv an anderen Verhaltensweisen und Entscheidungskriterien arbeiten. Und so lange es nicht genug Menschen in Entscheidungspositionen gibt, die sich für mehr Mitsprache, mehr Mitbestimmung, mehr Geld oder sogar institutionelle Veränderung einsetzen, müssen wir genau das als Gesellschaft von außen und innen weiter einfordern. Im Moment fühlt es sich allerdings eher so an, als könnten wir genauso gut von der Renovierung einer weit, sehr weit entfernten Bushaltestelle sprechen. Es hätte ähnlichen Erfolg.
|
Gleichzeitig wird die teils heftige Kritik, die den Institutionen entgegenschlägt, als „intensiv, irritierend und kränkend“ wahrgenommen  – und endet, wenn es ganz blöd läuft, am Ende in einer Art Pushback, indem die Arbeit mit marginalisierten Gruppen abgebrochen oder sogar in Zukunft vermieden wird. Statt sich als Institution zu fragen, welche migrantisierte, Schwarze und of Color Person in die Arbeit der Institutionen besser – oder überhaupt – eingebunden werden kann, sollten sich Institutionen fragen, warum sich niemand dafür schämt, zurücktritt oder die Geschäftsführung abgibt, weil die Programmgestaltung für eine gerechtere Kultur- und Kunstlandschaft stets im Außen der Institutionen agiert und meistens zusätzlich instrumentalisiert wird. Weil wir uns schon nicht für politische Realitäten schämen? Weil wir alle irgendwie davon profitieren? Sind wir als Gesellschaft doch so abgebrüht? Ist es das? – und endet, wenn es ganz blöd läuft, am Ende in einer Art Pushback, indem die Arbeit mit marginalisierten Gruppen abgebrochen oder sogar in Zukunft vermieden wird. Statt sich als Institution zu fragen, welche migrantisierte, Schwarze und of Color Person in die Arbeit der Institutionen besser – oder überhaupt – eingebunden werden kann, sollten sich Institutionen fragen, warum sich niemand dafür schämt, zurücktritt oder die Geschäftsführung abgibt, weil die Programmgestaltung für eine gerechtere Kultur- und Kunstlandschaft stets im Außen der Institutionen agiert und meistens zusätzlich instrumentalisiert wird. Weil wir uns schon nicht für politische Realitäten schämen? Weil wir alle irgendwie davon profitieren? Sind wir als Gesellschaft doch so abgebrüht? Ist es das?
|