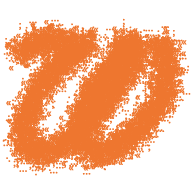Trần Thu Trang, Loud Quitting – warum Antidiskriminierung
und Dienst nach Vorschrift nicht zusammengehen
Trần Thu Trang, Loud Quitting
Trần Thu Trang
Loud Quitting – warum Antidiskriminierung
und Dienst nach Vorschrift nicht zusammengehen
Loud Quitting – warum Antidiskriminierung
und Dienst nach Vorschrift nicht zusammengehen
|
Am 10. Oktober 2023 veranstaltete die Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen in Berlin einen parlamentarischen Abend zur Kulturpolitik unter dem Thema „We Rise: Intersektionale feministische Kulturpolitik“. Als Schwerpunkt des Abends wurde eine chancengerechte Kulturpolitik angegeben; es war vom Anstoß eines Kulturwandels die Rede. Von zwölf anwesenden Fraktionsmitgliedern war lediglich eine Person Schwarz/nicht-weiß positioniert, was mich ehrlich gesagt schon gar nicht mehr stutzig macht. Denn oft ist es doch so, dass sich Diversitätsarbeit besonders im deutschen Kulturbetrieb zunehmend als neues Arbeitsfeld für eine woke bürgerlich-weiße Mittelschicht etabliert, wie meine Freund*innen Nuray und Michael bereits an anderer Stelle ausgeführt haben. Welche Konsequenzen zieht diese Tendenz aber für migrantisierte |
|
|
In meinem persönlichen oder beruflichen Umfeld gibt es kaum noch Menschen, die Mehrfachdiskriminierungen erfahren (z. B. Rassismus, Sexismus, Klassismus) und die (weiter) in einer Kulturinstitution arbeiten wollen. Wenn wir uns über unsere Arbeitserfahrungen austauschen, so fällt doch fast immer der Satz: „Die Institution ist nicht der richtige Ort für uns.“ Das ist schon bemerkenswert, haben Diversifizierungsvorhaben an eben jenen Institutionen doch seit Jahren Konjunktur. Von Bundesförderprogrammen wie „360° - Fonds für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft“ der Kulturstiftung des Bundes bis hin zu Landesprogrammen wie der Berliner „Diversitätsoffensive: Es werden hohe Summen an Steuergeldern zur Förderung von Diversität in den Kulturinstitutionen mobilisiert, oftmals profitieren diese finanziell und personell von mehreren Programmen gleichzeitig oder in zeitnaher Abfolge. Gleichzeitig scheint sich aber ein gegenläufiger Trend zu etablieren: Ein steigender Fachkräftemangel an sogenannten „diversen“ Mitarbeiter*innen in den Kulturinstitutionen. Viele Häuser haben Probleme, ihr diskriminierungskritisch versiertes Personal zu halten. Ich deute diesen Trend als widerständische Reaktion marginalisierter Kulturarbeiter*innen auf den klaffenden Widerspruch zwischen den Diversitätsperformances der Kulturhäuser und ihrem Ringen um den Erhalt der bestehenden weißen Strukturen. Eine Freundin schlug mir vor, diese Beobachtung als „Loud Quitting“ zu bezeichnen, also der lautstarken Widersetzung des Dienstes nach Vorschrift durch Kündigung, wodurch eine erneute Prekarisierung durch ungesicherte Einkommensverhältnisse in Kauf genommen wird. Aus weiteren Gesprächen mit Freund*innen, Kolleg*innen, Mitstreiter*innen kristallisierten sich immer mehr Gemeinsamkeiten in unseren Erfahrungen heraus, die zur Beendigung unserer Arbeitsverhältnisse durch „Loud Quitting“ führten. Im Folgenden skizziere ich jene Faktoren, die besonders auffällig waren. |
|
|
Zwei Jobs zum Lohn von einem Für migrantisierte Kulturarbeiter*innen ist die Arbeit in den Institutionen selten überwiegend inhaltlich, denn oft nehmen administrative und strukturbezogene Aufgaben überhand. Interdisziplinär vernetztes, kollaboratives und agiles Arbeiten, wie es oftmals in der jahrelangen Erfahrung prekarisierter Projektarbeit verfeinert worden ist, reibt sich nun an den langfristig vorausplanenden, vielfach in Subdisziplinen ausdifferenzierten Arbeitsweisen der Institution auf. Hinzu kommt, dass das eigene machtkritische und diskriminierungssensible Erfahrungswissen quasi als kostenloses Add-on abgefragt wird, gleichwohl es anderweitig personelle Ressourcen für Diversitätsarbeit gibt (etwa in Gestalt einer weißen Diversitätsreferent*in mit besagten Zertifikaten). |
|
|
„Wer Kultur sagt, sagt auch Verwaltung“ Entgegen ihrer Außendarstellung oder sogar Selbstverständnis als Hort der Konventionen brechenden Freigeister sind Kulturinstitutionen auch bürokratische Organisationen, welche die ihnen zugewiesenen Fördermittel verwalten, Ressourcen für künstlerische Vorhaben verteilen und Arbeitsabläufe reproduzieren. Doch entgegen der idealtypischen Vorstellung Max Webers sind Kulturinstitutionen eben nicht von transparenten Arbeitsabläufen, Zuständigkeiten, Regeln und machtbegrenzenden Mechanismen geprägt – zumindest nicht für rassifizierte und migrantisierte Menschen ohne bürgerlichen Habitus. Für viele Kulturarbeiter*innen mit Marginalisierungserfahrungen verläuft der berufliche Einstieg in die Kulturinstitution überhaupt nicht geradlinig. Bereits in der Ausbildung stoßen viele auf diskriminierende Hürden und so ist es nicht verwunderlich, dass ein großer Teil der Kulturarbeitenden erst über Umwege ihre Anstellung an einer Kulturinstitution findet und dann in Bereichen, die nicht unmittelbar die Hauptprogrammgestaltung tangieren, wie etwa Produktion, Vermittlung oder Diversitätsentwicklung. Den Kolleg*innen wird in der Regel kein diskriminierungssensibles Onboarding geboten, in denen bestehende Organisationsabläufe sowie der aktuelle Stand der Diversitätsentwicklung der Institution umfassend vorgestellt werden. Es gibt kaum In-House Mentoringprogramme, in denen neue Kolleg*innen durch Erfahrene im Einarbeitungsprozess unterstützt werden und institutionelles Wissen weitergegeben wird |
|
|
Strategische Ineffizienz der Kulturinstitution Die Arbeit marginalisierter Kolleg*innen stellt in der Verwaltungslogik oftmals die Abweichung von bestehenden Normen dar. Sei es durch die Einführung neuer ästhetischer Praktiken, die wiederum eine Anpassung der geläufigen Produktionsweisen einfordern. Oder die bloße Störung der sprachlichen Codes durch macht- und diskriminierungskritische Interventionen. Alles, was das Weißsein der Institution in die Sichtbarkeit holt, wird mit Widerständen begegnet. Ich gehe davon aus, dass eine Art des Widerstands dagegen die diskursive Verknappung von Ressourcen ist, sei es finanziell, zeitlich, personell oder räumlich. Dabei verfügt die Institution mit aller Sicherheit über einen Ermessungsspielraum für die Vergabe von Ressourcen. Ob diese in Transformationsprozesse investiert werden oder nicht obliegt keiner höheren Gewalt, sondern der Institution selbst. Ob dadurch möglicherweise produktive Konflikte ausgelöst werden, die einer engen Steuerung durch die Leitungsebene bedürfen, ist ebenso Resultat einer menschengemachten Entscheidung. Die Verweigerung dessen würde ich mit Sara Ahmeds Begriff der „strategischen Ineffizienz“ |
|
|
Von „Loud Quitting“ zu diskriminierungs- und machtkritischer Kulturpolitik
Lange Zeit bedeutete in diskriminierungskritischen Kontexten die Lösung aus diesem Dilemma, dass wir doch bitte den ganzen Kuchen bekommen sollten und nicht nur ein kleines Stückchen. Also die ganze Institution bekommen? Ich frage mich mittlerweile, ob das tatsächlich den verwalteten Charakter dieser Organisationen beseitigt oder nicht lediglich die Fassade etwas bunter streicht? Wie können sich Kulturinstitutionen von der Behauptung lossagen, dass die Verwaltung von Kulturproduktion und die Produktion von Kultur zwei komplett voneinander getrennte Sphären seien? Diskriminierungskritische Veränderungen sind radikale Veränderungen. Sie greifen nicht nur die programmatische, sondern immer auch die Strukturen und Arbeitsweisen der Kulturinstitution an. Die Verteilung von Ressourcen, Entscheidungsprozesse, die Umsetzung von Entscheidungen und die Gesamtverbesserung der Arbeitskultur – das sind meines Wissens selten Aspekte, die bei der diversitätsorientierten Entwicklung einer Kulturinstitution priorisiert angegangen werden. Für viele meiner Weggefährt*innen ist der Gedanke an eine Rückkehr in die Institution in weite Ferne gerückt. Wer hat denn noch Interesse daran, zum Fortbestehen weißer bürgerlicher Kulturproduktion beizutragen? Es ging doch eigentlich immer darum, die eigene soziale und politische Situierung künstlerisch zu reflektieren und zu bearbeiten. Also weniger darum, den bestehenden Kanon mit “divers” aussehenden Gesichtern und dem Sprachregister “der Straße” umzudekorieren. Vielleicht ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt für die Abkehr von der Kulturinstitution und damit auch der Vereinzelung in weißen Strukturen. Vereinzelt organisieren sich marginalisierte Kulturarbeiter*innen bereits politisch |
|
|
Notizen
|